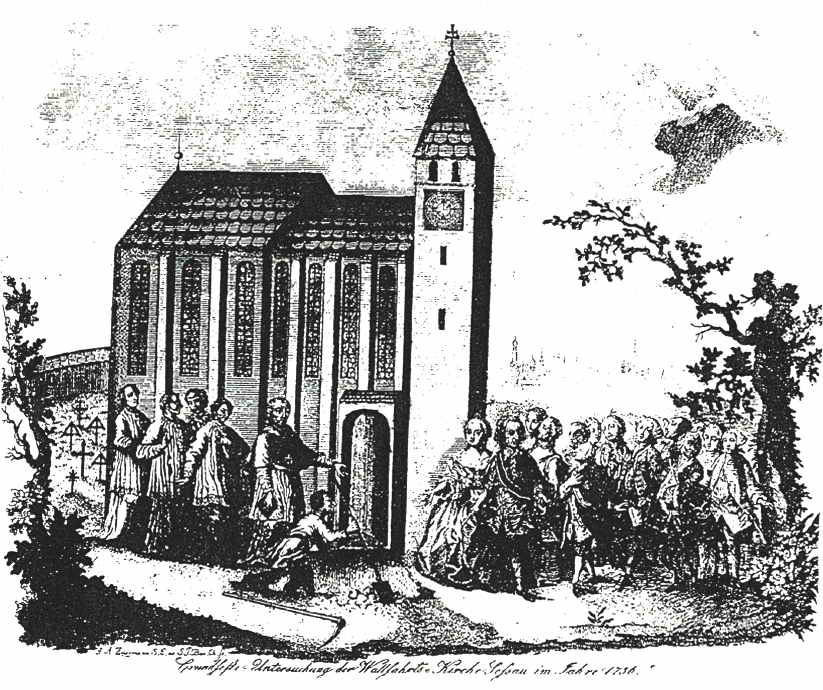Inhalt
VORWORT
Die Umgebung von Schlössern, Burgen und Klöstern war in der Vergangenheit ein reicher Nährboden für allerlei Sagen und Geschichten. Da machte der Raum in unserer Heimat keine Ausnahme. Viele dieser Sagen haben mit der tatsächlichen Geschichte einiges gemeinsam, sie geben der Wirklichkeit sogar noch die nötige Würze und wurden früher gerne mündlich weitergegeben.
An den kalten Winterabenden saßen einst beim Kerzenschein in den schummrigen Stuben die Kinder um den wärmenden Kachelofen und hörten den Erzählungen der Eltern und Großeltern andächtig zu, die ihnen die Geschichten und Sagen gerne erzählten.
Gut, daß es in der Vergangenheit Menschen gegeben hat, die diese zu Papier brachten und so vor dem Vergessen bewahrten; denn wer hat heute noch Zeit, wenn der Fernseher eingeschaltet ist, diese Geschichten weiterzugeben.
Ich habe schon 1961 für den Schulgebrauch eine Sammlung unter dem Titel „Sagen und Geschichten im Landkreis Bogen“ an alle Schulleitungen vervielfältigt. In diesem Büchlein werden nun diese für die nähere Heimat zusammengefaßt, damit auch die nachkommenden Generationen darin lesen können und sich an ihnen erfreuen.
Hunderdorf, im Jahre 1999
K.Klar,
Chronist der VG
Raum Hunderdorf
Wie Eglsee entstanden ist
In Bayern gibt es 19 Orte mit der Bezeichnung Eglsee. Rechts der Straße von Hunderdorf nach Bogen finden wir die Einöde Eglsee. EMMI BOCK schreibt in ihrer Sagensammlung über die Entstehung des Namens Eglsee: Wo heute sich die Kolonie Eglsee befindet, war früher ein weiter, tiefer See, der inmitten eines herrlichen Waldes lag. Im Laufe der Zeit ist dieser See immer mehr ausgetrocknet und versiegt, bis schließlich der jetzt noch vorhandene kleine Weiher übrig blieb. Den See soll eine auffallend große Menge Seeigel bewohnt haben) daher der Name Eglsee, der sich dann auf die später hier entstandene Ortschaft übertrug.
Der weggerückte Grenzstein
Vom Kloster Windberg führt ein schmaler Weg bergab zur naheliegen Ortschaft Hofdorf in der Gemeinde Hunderdorf. Vorbei an der stillgelegten Müllhalde, durch einen Hohlweg kommt man an ein Marterl aus dem vergangenen Jahrhundert, das in der Amannwiese steht. Diesen Weg gingen die Hofdorfer, wenn sie zur Kirche nach Windberg wollten, denn Hofdorf war früher eine Hofmark des Klosters Windberg. Aber auch weniger gläubige Menschen benützten den Pfad, denn in Windberg gab es auch ein gutes Bier, das in der Klosterbrauerei gebraut wurde. So mancher Kirchgänger blieb nach der Messe in der Klosterschänke) um zu später Stunde den steilen Weg nach Hofdorf hinunter zu taumeln.
So ging vor langer Zeit ein gewisser Strohmeier heimwärts nach Hofdorf, wo ihn seine angetraute Ehehälfte schon sehnsüchtig erwartete. Auf halbem Wege bei der Amanwiese sprach ihn plötzlich eine Stimme an:“Wou muß i eahm hintoa?“ Gemeint war ein weggerückter Grenzstein, den ein bereits Verstorbener zu Lebzeiten ausgegraben hatte und nun als Geist keine Ruhe finden konnte.
Strohmeier, erschreckt und vom Klosterbier selig, antwortete: „Do wo‘ s eahm ghoit hast!“ – Drei Tage später war Strohmeier nicht mehr unter den Lebenden. Seit dieser Zeit erinnert ein Marterl an diese Begebenheit, die der Großvater des verstorbenen Bürgermeisters Anton Kittenhofer von Windberg, Josef Kittenhofer (1851-1929), selbst 18 Jahre Bürgermeister von Windberg, seinen Söhnen und Enkeln erzählt hat.
Den genannten Kirchenweg geht heute kaum mehr jemand, denn die Hofdorfer besuchen seit langem lieber die Pfarrkirche zu Hunderdorf. 1998 wurde die Steinsäule entfernt und bei Sternhäusl in Windberg wieder aufgestellt.
Der Schatz in Lindenbrunn
Lindenbrunn ist eine Einöde in der Gemeinde Hunderdorf. Als die Schweden im Lande hausten, bargen die Windberger Mönche all ihre Geld- und Silberschätze in einer eisernen Truhe. Diese vergruben zwei Patres in Lindenbrunn, das damals zum Kloster gehörte. Die Schweden kamen, plünderten das Kloster und erschlugen die zwei Mönche. Niemand wußte, wo der Schatz vergraben war. An einem Fronleichnamstag, als alle Leute bei der Prozession waren, gruben heimlich drei Burschen nach der Truhe. Tatsächlich fanden sie dieselbe und hoben sie aus der Grube. Als sie den Schatz voll Goldgier mitnehmen wollten, läuteten die Glocken gerade den ersten Segen. Da tat es einen furchtbaren Donnerschlag und der Blitz fuhr zur Erde. Die Kiste mit dem Gold versank im Boden. Von den drei Burschen hörte man nichts mehr.(Verfasser unbekannt)
Die Prophezeiungen des „Mühlhiasl“
In die Zukunft zu blicken war schon von jeher ein Wunschtraum der Menschen. Die Vergangenheit kannte Orakel, Wahrsager und Wahrsagerinnen. Sterne, Karten und Handlinien dienten dabei als zweifelhaftes Werkzeug.
Der „Mühlhiasl“ von Apoig bei Hunderdorf hielt aber nichts von diesen Dingen; er hatte „Gesichte.“ Seine Prophezeiungen kamen aus ihm selbst. Gelebt hat der „Mühlhiasl“ – oder Matthias Lang, wie sein bürgerlicher Name war – vor gut 200 Jahren in der Mühle zu Apoig bei Hunderdorf. Auch heute steht dort noch die ehemalige Mühle, die jedoch später errichtet wurde.
Seine Prophezeiungen sind nicht aufgeschrieben worden, sie wurden von Mund zu Mund weitererzählt. Manches von dem, was er voraussagte, ist tatsächlich eingetroffen.
Prämonstratenser Herren von Windberg haben den „Mühlhiasl“ einmal in die Kur genommen und suchten ihm seine Prophezeiungen auszureden. Aber der „Mühlhiasl“ blieb dabei stehen. Als alles gute Zureden nichts half, wiesen sie ihm schließlich die Tür. Da hat der „Mühlhiasl“ gesagt: „So gewiß als ich jetzt heraus muß, so gewiß müßt ihr auch bald heraus.“ Und siehe, es kam die Klosteraufhebung 1803, und die Klosterherren verließen Windberg.
Daß seine Wahrsagungen zutrafen, dafür ist er selber ein Beweis. Er hatte gesagt: „Ich komme euch auch als Toter noch aus.“ Als sein Leichnam von dem Ochsengespann zur Beerdigung gefahren wurde, da machten die Ochsen bei einer großen Senkung des Weges einen Sprung, und die Totentruhe mit dem Leichnam rollte hinab und mußte wieder heraufgeholt werden.
Doch lassen wir den „Mühlhiasl“ zu Worte kommen. Freilich wird sich schwer feststellen lassen, was genau vom „Mühlhiasl“ stammt und was etwa von anderen hinzugekommen oder im Laufe der Zeit verändert worden ist.
„Wenn die schwarze Straße von Passau heraufkommt, wenn die schwarze Straße ins Böhmen hineingeht, wenn die Rabenköpfe (?) kommen, wenn die Bauern mit gewichsten Stiefeln in die Mistgrube hineinstehen, wenn sich die Bauernkleiden wie die Städtischen und die Städtischen wie die Narren, wenn alle Bauern politisieren, dann wird die Welt wieder abgeräumt.
Es wird ein Krieg kommen. In diesem Krieg wird eine scheinbare Ruhe eintreten, dann aber kommt es, daß die Leute wieder so wenig werden, daß die Brennessel und die Brombeerdörner zum Fenster  herauswachsen. So wenig werden die Leute, daß, wenn sich noch etliche begegnen, wenn alles vorbei ist, sie Bruder und Schwester zu einander sagen werden.
herauswachsen. So wenig werden die Leute, daß, wenn sich noch etliche begegnen, wenn alles vorbei ist, sie Bruder und Schwester zu einander sagen werden.
Das Holz wird so teuer wie der Zucker, aber langen tut es. Wenn man im Gäuboden oder am Donaustrand noch eine Kuh findet, soll man ihr eine goldene Glocke anhängen, aber im Wald werden doch noch die Gockel krähen.
So vielerlei Geld wird gemacht, daß man es gar nicht mehr kennen kann, aber auf einmal gibt es keines mehr. Einerlei Geld kommt auf, die am meisten besitzen, haben auf einmal nichts mehr.
Häuser werden gebaut wie die Schlösser und Pfarrhöfe, Schulhäuser wie Paläste für die Soldaten. Es wird auch eine große Häuser- und Wohnungsnot kommen, obwohl die Städte so groß und fünf- bis sechsstöckige Häuser gebaut werden, und auch auf dem Lande wird alles voll Häuser sein. Die ganzen Lindacher Berge werden voll Häuser und Lehmhütten angeschlett. Zu Hunderdorf wird ein Halls gebaut, des, wird vor diesen Ereignissen schon lange stehen, aber nicht ausgebaut.
Alleweil werden Missionen gehalten und viel über den Glauben gepredigt, kein Mensch kehrt sich mehr daran, und die Leute werden erst recht schlecht.
Die Religion wird so klein und schwach, daß man den ganzen Glauben in einen Hut hineinbringt und mit einer schnappenden Geißel die wenigen Gläubigen vertreiben kann. Es werden aber, wenn die Leute einmal wieder ganz wenig sind, nach diesen großen Umwälzungen heilige Priester, besonders heilige Ordensleute den Glauben wieder neu lebendig machen und werden große Zeichen und Wunder tun. Es wird auch vorher der Glaube an Weizzen und Geister abgeschafft, die Weizzen vom Papst verbannt werden, aber die Neueinführung des heiligen Glaubens wieder so häufig wie früher auftreten und das Volk zwingen, wieder zu glauben.
Bevor dieses geschieht, werden die Leute so viel und so bös, die eigenen Christen den Glauben am meisten verspotten, weil sie alles auf ihre Weisheit setzen und Gottes Allmacht nicht mehr kennen werden, weil sie in der Luft fliegen und auf der Straße mit Wagen fahren, welche von selber laufen können. Besonders aber werden die meisten Leute auf zweirädrigen Karren fahren, so schnell, daß kein Pferd und kein Hund mitlaufen kann. In der Donau wird- ein eiserner Hund heraufbellen (Dampfer) und über die Donau eine eiserne Straße führen.
Über den Pilgramsberg wird eine Straße gebaut und auf dieser Straße werden sie herauskommen diese Roten.“ Wenn er gefragt wurde, ob diese Roten die Franzosen seien, sagte er, daß es keine Franzosen seien, auch nicht rote Hosen oder Joppen anhaben werden. Er könne nur sagen, daß es Rote sein werden. Wenn sie kommen, soll man sich im Perlbachtal in den großen Hölzern und auf  der Käsplatte bei Englmar verstecken und in die Weizenmandl verstecken. So schnell kommts und vergehts, daß man es mit drei Laib Brot überleben kann, und so schnell muß man laufen, daß man, wenn man ein Laib Brot verliert, diesen liegen lassen muß, auch den zweiten, man kann es auch noch mit einem aushalten.
der Käsplatte bei Englmar verstecken und in die Weizenmandl verstecken. So schnell kommts und vergehts, daß man es mit drei Laib Brot überleben kann, und so schnell muß man laufen, daß man, wenn man ein Laib Brot verliert, diesen liegen lassen muß, auch den zweiten, man kann es auch noch mit einem aushalten.
Das Bayerland wird verheert und verzehrt von seinem eigenen Zorn. Am längsten geht es her, aber am schlechtesten geht es ihm. Wenn die Leut nichts mehr tun als fressen und saufen, schlemmen und dämmen, wenn auch Bauernleut lauter Kuchen fressen, wenn sie d’Hendl und Gäns selber fressen, – wenn Bauern alle Grenzsteine umackern und alle Hecken aushauen, wenn Bauern alle politisieren.. …nachher ist die Zeit da. (Von L. Häusler und J. B. Raun)
Im Windberger Raum
Die Sage von der Entstehung Windbergs
Vor mehr als einem Jahrtausend trug es sich zu, daß ein einsamer Wanderer aus dem Sachsenlande auf den Ausläufer des Donaugebirges kam, auf welchem heute Windberg steht. Das Gebiet war damals mit dichtem, undurchdringlichen Wald bewachsen. Der Wanderer hörte auf den Namen Winith und war auf der Suche nach seinem Bruder, der von einem fremden Kriegsvolke entführt worden war. uf dem Ausläufer legte er sich nieder, um von den großen Anstrengungen seiner Wanderschaft auszuruhen. Kaum hatte er sich niedergelegt, so schlief er auch schon ein.
Da hatte er einen wunderbaren Traum. Er sah im Traum, wie ein großer Adler durch die Luft zu ihm niederschwebte. Das Fluggeräusch dieses großen Vogels erschütterte die Luft. Der Adler ließ sich neben Winith nieder, berührte ihn mit seinen Schwingen und sprach: „Stehe auf und gehe an den großen Fluß, dort werden dir Wanderer begegnen. Forsche unter ihnen nach dem, der auch Winith heißt. Dieser Namensgenosse wird dein Bruder und dein Mitarbeiter sein.“
Als Winith erwachte, begab er sich sofort an den großen Fluß, die Donau. Es dauerte nicht lange, da kamen Wanderer des Weges. Winith fragte, ob einer unter ihnen sei, der Winith hieße. Wie der Adler vorausgesagt hatte, fand sich unter den Wanderern tatsächlich ein Winith. Nun forschte der Winith, der den sonderbaren Traum hatte, den Wanderer aus. Er fragte ihn, aus welchem Lande, welcher Gegend und welchem Geschlechte er stammte. Zu seiner Verwunderung erhielt er die Antwort: „Ich stamme aus dem Sachsenlande und wurde als kleiner Knabe von fremden Kriegern meiner Mutter entrissen und fortgeschleppt.“ Da wurde er wieder gefragt, wer seine Mutter gewesen sei. „Meine Mutter hieß Sophia“, gab der Fremde zur Antwort. Als Winith dies hörte, fiel er dem Fremden um den Hals und beide weinten vor Freude, denn sie waren leibliche Brüder. Man wunderte sich, daß zwei Brüder den gleichen Namen trugen. Die Mutter konnte das geraubte Kind nicht vergessen und ließ ihren zweiten Jungen auch auf den Namen Winith taufen.
Nun erzählte Winith seinem Bruder seinen sonderbaren Traum, der ihn zu seinem Bruder führte. Er sagte ihm auch noch daß er zur Ehre und Verherrlichung Gottes auf jenem Platze, wo er den Traum hatte, ein Gotteshaus zu errichten gedenke. Der Bruder stimmte diesem Plan zu. Die beiden zogen an den Ort zurück, wo sie im Laufe der Jahre eine Kirche erbauten. Sie erwarben auch Reliquien, die unter dem Beistande des Priesters Azelinus in den Altar eingebaut wurden. Um die Kirche herum siedelten sich auch andere Menschen an, und so entstand Winithberg, das heutige Windberg. (Aufgeschrieben von OL M. Engelhart)
Die Sage vom Engelsberg
Die Kirche in Windberg ist die älteste im Altlandkreis Bogen. Bald nach der Gründung des Klosters begann der erste Abt Gebhard von Bedenburg im Jahre 1142 mit dem Bau der Kirche. Von weither wurden die Steine mit Ochsenwagen nach Windberg gebracht. Hier wurden sie zurechtgehauen und zum Bau verwendet. Die Bauarbeiten kosteten viel Geld. Die Sage erzählt, daß die Chorherren einmal kein Geld mehr hatten, um weiter bauen zu können. Da schickte der liebe Gott einen Engel mit einem Wagen, auf welchem ein Sack mit Geld lag. Als der Engel in die Nähe von Irensfelden kam, konnte er vor Müdigkeit nicht mehr weiter; er legte sich auf einen Stein und schlief ein. Im Schlaf wurde der Stein weich, und sein Kopf bildete sich ab. Seit dieser Zeit heißt der Berg, auf dem der Stein liegt, Engelsberg. (wie oben)
Der Ochsentritt in der Kirche zu Windberg
An einem blinden Fenster des südlichen Querschiffes, nahe der Sakristei der jetzigen Pfarrkirche und ehemaligen Klosterkirche zu Windberg befindet sich ein alter rostiger Nagel, unter welchem sich folgende Inschrift befindet: „Sack, worinnen ein Ochs den Leib des hl. Sabinus überbracht“. Der Sack, ehemals aus Leder, der einst an diesem Nagel hing, fiel dem Zeitlaufe zum Opfer, während der Nagel und die Inschrift allen Unbilden der Zeit erhalten geblieben sind bis zur Gegenwart. Die Schrift weist deutlich darauf hin, daß in einem Sacke die Reliquien des hl. Sabinus nach Windberg überbracht wurden.
Der hl. Sabinus, der zweite Patron der ehemaligen Klosterkirche, war zur Zeit des römischen Kaisers Diokletian Bischof von Assisi. Als Bischof und Christ wurde er vom Statthalter Venustianus in den Kerker geworfen. Bei der gegen ihn geführten Gerichtsverhandlung zerztümmerte er ein heidnisches Götterbild, worauf ihm beide Hände abgehackt wurden. Im Kerker wirkte der gemarterte Bischof Wunder. Einem Enkel der hl. Serena gab er mit Gottes Hilfe das Augenlicht wieder. Als der Statthalter, der auch ein Augenleiden hatte und furchtbare Schmerzen erdulden mußte, dies hörte, bat er den Heiligen, auch ihm zu helfen. Bischof Sabinus erteilte ihm Unterricht im Glauben und befreite ihn vom Augenleiden. Daraufhin ließ sich der Statthalter taufen. Als Kaiser Diokletian dies hörte, ließ er den Statthalter mit seiner gesamten Familie enthaupten und den heiligen Bischof Sabinus zu Tode geißeln.
Viele Jahrhunderte später, im Jahre 1197, überbrachte Graf Albert III. von Bogen die Gebeine des hl. Sabinus nach Windberg. Graf Albert hatte in seiner bewegten Jugend nichts von der Frömmigkeit des Grafen Albert I., seines Großvaters; aufzuweisen. Er war ein streitsüchtiger, kriegsliebender Mann, der zu seinen Kriegen viel Geld benötigte, er hieß deshalb auch Albert der Wilde. Neben seinen Untertanen mußten auch die Stifte Windberg und Oberalteich immer wieder ihre Kassen leeren und das Geld dem Grafen übergeben. Wegen seines dauernden Unfriedens wurde der Graf durch Kaiser Heinrich VI. nach Apulien in Unteritalien verbannt.
In der Verbannung diente er dem römischen Kaiser. Nach langen Wochen des Trotzes versuchte der Bogener, dem Kaiser Beweise seiner Loyalität zu liefern. Aber dieser übersah ihn. So wartete er auf eine günstige Gelegenheit, um den Kaiser für sich milde zu stimmen. Dies sollte sich bald bieten. Kaiserin Konstanze, eine ehemalige Nonne, war nach neun Jahren Ehe endlich guter Hoffnung. Im Herbst des Jahres 1194 brach der Kaiser nach Sizilien auf, um sich zum Nachfolger der „Könige von Afrika“ krönen zu lassen. Gerade in dieser Zeit brachte die Kaiserin Konstanze einen gesunden Jungen zur Welt. Dies schien Albert die günstige Gelegenheit zu sein.
Unter den größten Strapazen brachte er von Ascona aus reitend die Nachricht auf den Hof von Palermo. Die Freude des Kaisers war übergroß und er sprach zu dem Grafen: „Geh zurück in deinen Grafengau im Nordwald, zur böhmischen Ludmilla und deinen drei Söhnen; und wähl dir nach südländischem Muster ein Wappen für deinen Schild“. Albert nahm helle und dunkle Schiefecke für all die Tage und Nächte, die er als Verfemter durchleben mußte. Dann zog er nordwärts.
Um dem Kloster Windberg für die an ihm verübten Ungerechtigkeiten eine Entschädigung zu bieten, stahl er in der vom Kaiser Barbarossa niedergeworfenen Stadt Spolet in einer Seitenkapelle des Doms die vollständig erhaltenen Gebeine des Märtyrers Sabinus. Er erbrach den kostbaren, mit Edelsteinen besetzten Schrein und brachte die Reliquien des hl. Sabinus in einem Ledersack nach Windberg und schenkte sie dem Kloster.
Der Sage nach beförderte ein Ochse auf seinem Rücken den kostbaren Schatz. Der Ochse blieb in Windberg auf einen Felsstein stehen und hinterließ in diesem den Abdruck seiner Klauen, denn der Stein war wachsweich geworden. Der Stein wird heute noch der „Ochsentritt“ genannt und ist neben dem Sabinusaltar eingemauert. Hier ist er heute noch zu sehen. (Verfasser unbekannt)
Die Windberger Schwedenmärtyrer
Im Kapitelsaal des Klosters Windberg befinden sich zwei eichene Truhen mit schönen Zinnbeschlägen. Eigentlich sind es Reliquienschreine, aber der uneingeweihte Besucher möchte beim Hineinschauen den Inhalt für altes Gerümpel halten. Wir stehen hier bei den Überresten von zwei Chorherren des Klosters, die im Dreißigjährigen Kriege um ihres Glaubens willen ihr Leben gelassen haben. Windberg hat in diesem Kriege, der so viele Klöster samt ihren Kirchen- und Archivschätzen völlig verwüstete, eigentlich wenig gelitten. Die Schweden erschienen zweimal, 1634 und 1644, beide Male floh der Konvent mit seinen Wertsachen. Das Kloster wurde nicht zerstört, nur geplündert, aber jedesmal ermordeten die Schweden einen Pater. Dies geschah damals oft. Der ganze Krieg ging ja damals um den Glauben. Die Schweden betrachteten sich als die Verfechter des protestantischen Glaubens, die Klöster galten als die „Hochburgen der Päpstler“, und Toleranz kannte man damals nicht.
Der erste der beiden Märtyrer war Pater Norbert Höcht. Er war Ende des 16. Jhs. in Regensburg geboren und jung in das Kloster eingetreten. In dem neuen Reformgeist, den Andreas Vögele seit 1598 ins erschlaffte Kloster gebracht hatte, war er erzogen worden. Damals kam auch der Brauch der Klosternamen auf; der junge Thomas Höcht war der erste, der im Kloster Windberg bei der Einkleidung den Namen des Ordensstifters Norbert bekam. Er studierte Theologie in Ingolstadt, wurde 1618 zum Priester geweiht und machte im folgendem Jahr zusammen mit dem späteren Abt Sabinus Aigenmann in Regensburg die Pfarrkura. Er blieb in den folgenden Jahren im Kloster, wo er das Amt des Novizenmeisters verwaltete und nach Kräften in der Seelsorge aushalf. Für ein Pfarramt hielt man ihn wegen seiner schwächlichen Gesundheit wohl nicht für geeignet. Zuletzt war er auch nebenbei Kooperator von Windberg.
Am 25.November 1634 kamen die Schweden das erste Mal nach Windberg. Alles war geflohen, nur Pater Norbert hatte sich freiwillig erboten, zur Wahrnehmung der Seelsorge zurückzubleiben. Schonungslos und beutegierig trieb die Soldateska ihr Unwesen, und die Enttäuschung, da sie in dem ansehnlichen Kloster nicht die gleichen Schätze vorfanden wie in Oberalteich, steigerte ihre Wut. Sie suchten nach den Chorherren und nach deren „Reichtümern“, plünderten alles, fanden aber nicht viel und wollten schon abziehen. Da kamen zwei Schweden zufällig am Haus des Lehrers vorbei. Durchs Fenster sahen sie den weißen Mönch, der gerade den Kindern Katechese gab. Sie stürmten hinein und bedrohten ihn mit dem Schwerte. Pater Norbert griff nach einem vor ihm stehenden Kruzifix, um sich zu verteidigen. Da traf ihn ein Soldat mit dem Schwerte so wuchtig auf den Kopf, daß er blutüberströmt zusammensank. Die Schulkinder schrien und weinten. So starb Pater Norbert Höcht. „In odium fidei occius“, aus Haß gegen den Glauben ermordet – so steht auf seinem Grabstein, der 1932 zufällig in einem Kuhstall eines Anwesens in Staudach entdeckt wurde. Im Kreuzgang wurde der Märtyrer begraben.
Erst zehn Jahre später, am 23.März 1644, kamen die Schweden wieder. Auch dieses Mal floh der ganze Konvent mit allen Wertsachen, man ließ aber zur Vorsicht niemand zurück. Die Wut und die Beutegier der Soldatenhorden war diesmal noch größer, und so suchten sie in der ganzen Umgebung nach den Chorherren, um wenigstens einen zu erwischen, aus dem sie durch Folter das Versteck der vermeintlichen Schätze erfahren könnten. Das Opfer war diesmal Pater Urban Mittermayer. Pater Urban stammte aus einer achtbaren Straubinger Familie, er selbst scheint nicht dort geboren zu sein. Ein Verwandter von ihm, Ulrich Mittermayer, war jedenfalls 1616 Straubinger Ratsherr. Nach der Tradition war Pater Urban Pfarrer in einer dem Kloster einverleibten Pfarrei, und zwar soll es Englmar gewesen sein. Doch in jeder Klosterpfarrei, auch in Englmar, war 1644 nachweislich ein anderer Pfarrer. Das Todesjahr ist sicher richtig, und so müssen wir annehmen, daß Pater Urban als Kooperator oder Hilfspriester sich in Englmar aufhielt. Der eigentliche Pfarrer, Pater Anton Kiendl, war wohl gleichfalls geflohen, und so fanden die Schweden ihn allein vor. Sie wollten von ihm den Aufenthalt des Abtes und der Konventualen erpressen, und als Pater Urban standhaft die Aussage verweigerte, verabreichten sie ihm den sogenannten Schwedentrunk. Das war eine gräßliche Marter. Das Opfer wurde gebunden auf den Boden gelegt, dann flößte man ihm mit einem großen Trichter so viel Jauche ein, bis der Bauch voll und prall war. Dann trampelte einer solange auf dem Bauch herum, bis der Ärmste die Jauche mit viel Blut vermischt wieder von sich gab. Die meisten starben unter dieser Qual, und so ging es auch Pater Urban. Er wurde wie sein Leidensgenosse zehn Jahre vorher, im Kreuzgang begraben. Als dieser 1720 wegen des Klosterneubaues fast völlig abgebrochen wurde, wurden die Gebeine der beiden Märtyrer mit besonderer Ehrfurcht erhoben. Man fand dieselben noch ganz unvermodert. Im Schädel des Paters Norbert war ein großes Loch. Wir können heute noch feststellen, daß dieser eine hünenhafte Figur und ein sehr gesundes Gebiß hatte.
Die Gebeine wurden zunächst in der Kapelle des hl. Laurentius bestattet, die heute nicht mehr existiert. Dann wollte man nach dem damaligen Gebrauch dieselben verzieren und ausstellen, und zu diesem Zweck wurden sie den Nonnen des Benediktinerinnenklosters St. Georg in Prag anvertraut. Daß Abt Augustin Schmidbauer sie so weit fortschickte, hing wohl damit zusammen, daß er mit dem Abt des Klosters Strahov in Prag eng befreundet war. Dort ruhten die Gebeine des hl. Ordensstifters Norbert, und die Benediktinerinnen von St. Georg waren mit der Ausschmückung derselben beauftragt worden. Die kahlen Schädel wurden mit goldenen Kronen versehen, alles wurde mit Brokat und Flitter aller Art überzogen, mit falschen Perlen und Edelsteinen wurde nicht gespart… wir würden heute so etwas nicht mehr tun. Aber man war eben in der Barockzeit. Die Gebeine unserer Märtyrer wurden zunächst nach Strahov geschickt, und es fügte sich, daß ein Chorherr des böhmischen Stiftes Seelau, Pater Daniel Schindler, der gerade dort weilte, dieselben nach St. Georg überbrachte. Bei dieser Gelegenheit ereignete sich etwas Auffallendes. Im Sprechzimmer des Klosters war gerade eine Frau anwesend, die einen Säugling auf dem Arm trug. Als Pater Daniel den Schädel Pater Urbans aus der Kiste nahm, um einer Nonne den Hergang des Martyriums zu schildern, begann der Säugling zu schreien, streckte seine Händchen nach dem Totenschädel aus und gab mit allen Mitteln zu erkennen, daß er denselben haben wollte. Man suchte ihn zu beruhigen, in der berechtigten Annahme, daß so ein Schädel kein geeignetes Spielzeug sei. Doch das Kind hörte nicht auf zu schreien und zu weinen und gab erst Ruhe, als man ihm das Haupt in die Ärmchen legte. Nun schien er überglücklich, streichelte und umarmte es, und als man ihm es mit Mühe wieder entriß, gab es wieder viele Tränen. Die Anwesenden waren erstaunt und ergriffen zugleich und sahen in dem Vorgang einen übernatürlichen Eingriff. Das Kloster Windberg ist natürlich stolz auf seine beiden Blutzeugen. Es steht jedoch in keinem der beiden Fälle fest, ob es sich um ein Märtyrium im eigentlichen Sinne handelt. Ein solches liegt nämlich vor, wenn der Betreffende auf wiederholte Aufforderung und Gewaltandrohung sich weigert, den Glauben zu verleugnen, beziehungsweise eine schwere Sünde zu tun. Wir wissen aber nicht, ob und wieweit dies hier der Fall war. Wer aus Haß gegen den Glauben getötet wird, kann nur im uneigentlichen Sinne als Märtyrer bezeichnet werden.
Bei der Säkularisation 1803 wurden die Gebeine durcheinander geworfen und ihres Zierrats beraubt. Die Kisten, die noch das Siegel des Abtes Bernhard Strelin (1734-77) tragen, standen dann in einer Rumpelkammer des Pfarrhofes, bis sie in neuerer Zeit wieder in das Kloster übertragen wurden. Die Spitze des Schwertes, mit der Pater Norbert ermordet wurde, das Kruzifix, das er den Schweden entgegenhielt, sowie einige Brokatfetzen finden sich noch in einer Kiste. (Nach Pater Norbert Backmund)
Sage von der Entstehung der Kirche Hl. Kreuz
Gegen Ende des 17.Jahrhunderts war Franziskus Knodt Abt des Klosters Windberg. Eng befreundet zu ihm war der Dekan von Aufhausen Georg Seidenbusch. Der Dekan verbrachte alljährlich seinen Urlaub in der klösterlichen Einsamkeit in Windberg. Auch im Jahre 1692 kam er wieder nach Windberg. Er liebte es, in den frühen Morgenstunden das Kloster zu verlassen und sich in der nahen Umgebung zu ergehen, Betrachtungen über Gott und die Welt anzustellen. Eines Morgens ging er bereits um die dritte Stunde aus dem Kloster. Auf der Kuppe des Berges, auf dem heute die Wallfahrtskirche steht, setzte er sich auf einen Stein, um auszuruhen. In der Morgenstille überfiel ihn ein leichter Schlummer mit einem wunderbaren Traum. Ihm träumte, er könne von seinem Ruheplatz seine Gemeinde, die Pfarrei Aufhausen erblicken. Vom Schlaf erwacht, blickte er in die Richtung seiner Pfarrei und war ehrlich verwundert, tatsächlich den Turm seiner geliebten Pfarrkirche zu sehen. Sofort schnitt er ein Birkenzweiglein ab und formte daraus ein Kreuzchen, das er neben seinem Ruheplatze in die Erde steckte.
In das Kloster zurückgekehrt, erzählte er seinem Freunde, dem Abte  Knodt, seinen wunderbaren Traum und fügte hinzu, Aufhausen wahrlich erblickt zu haben. Dekan Seidenbusch überreichte dem Äbte einen Dukaten und bat ihn, anstelle des Birkenkreuzes ein hohes Holzkreuz aufstellen zu lassen. Nach der Errichtung des „hohen Kreuzes“, wie es im Volksmunde geheißen wurde, kamen fromme Christen zu dem Kreuze und fanden auf wunderbare Weise Trost und Erhörung ihrer Bitten. Dies bewog den Abt Franziskus Knodt, statt des Kreuzes ein Kirchlein zu erbauen. Es wurde 1695 fertiggestellt, Dekan Seidenbusch spendete hierzu ein hölzernes Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert, das über 200 Jahre in Regensburg unter Schutt und Trümmern gelegen war. Dieses Kreuz wurde in feierlicher Prozession nach Windberg gebracht und ziert heute noch die Wallfahrtskirche. (Nach Pater Norbert Backmund)
Knodt, seinen wunderbaren Traum und fügte hinzu, Aufhausen wahrlich erblickt zu haben. Dekan Seidenbusch überreichte dem Äbte einen Dukaten und bat ihn, anstelle des Birkenkreuzes ein hohes Holzkreuz aufstellen zu lassen. Nach der Errichtung des „hohen Kreuzes“, wie es im Volksmunde geheißen wurde, kamen fromme Christen zu dem Kreuze und fanden auf wunderbare Weise Trost und Erhörung ihrer Bitten. Dies bewog den Abt Franziskus Knodt, statt des Kreuzes ein Kirchlein zu erbauen. Es wurde 1695 fertiggestellt, Dekan Seidenbusch spendete hierzu ein hölzernes Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert, das über 200 Jahre in Regensburg unter Schutt und Trümmern gelegen war. Dieses Kreuz wurde in feierlicher Prozession nach Windberg gebracht und ziert heute noch die Wallfahrtskirche. (Nach Pater Norbert Backmund)
Die zertrümmerten Monstranzen
Als man das Kloster Windberg um 1803 seiner Schätze beraubte, wurden die Kelche und Monstranzen zum Klosterschmied Plager gebracht, damit er sie auf dem Amboß zertrümmere. So konnte das Gold besser transportiert werden. Dabei war es unvermeidlich, daß einzelne Goldsplitter in der ganzen Schmiede zerstreut herumlagen. Plager soll etwas kräftiger zugeschlagen haben, als es notwendig war, denn auch ihn ärgerte die mutwillige Vernichtung des Klostergutes. Aus vielen kleinen Überresten, die der Schmied nachher eingesammelt hatte, ließ man später schöne Schließspangen für Rauchmäntel anfertigen. so konnte der Schmied den goldgierigen Zertrümmerungskommissaren noch ein kleines Schnippchen drehen.
Mitgeteilt vom ehem. Bürgermeister A. Kittenhofer
Der Teufel in der Lederhose
Der Bruder des früheren Bürgermeisters Josef Kittenhofer von Windberg (1851-1929), Hans Kittenhofer von Wachsenberg, war in seiner Jugend in Mitterfels in der Lehre. Nach verbrachtem Wochenende im elterlichen Haus begleitete ihn am Sonntag abend seine Mutter durch den finsteren Wald bis kurz vor Mitterfels. Der Junge trug einen Laib Brot unter dem Arm, da die Verpflegung beim Lehrherrn den Hunger des Jungen nicht immer stillen konnte. Damals gab es noch keine Eisenbahn in unserer Heimat. An der Stelle, wo später der Bahnhof von Mitterfels stand, bemerkten sie eine seltsame Gestalt in Lederhosen, die auf einem Baumstumpf saß und sich recht merkwürdig gebärdete. Beiden war es nicht geheuer, und sie machten einen weiten Bogen um die seltsame Erscheinung. Bald erfuhr auch der Ortsgeistliche davon, und da sich kaum mehr jemand der Stelle zu nähern wagte, beschloß er, mit seinen Ministranten, ausgerüstet mit Weihrauch und Weihwasser, dem Unwesen ein Ende zu bereiten. Doch wie groß war das Entsetzen, als die genannte Gestalt dem Pfarrer alle seine Fehler und Sünden entgegenschleuderte. So kehrte der Geistliche unverrichteter Dinge in den Ort zurück. Erst als in Mitterfels ein neuer, unschuldiger Kooperator in sein Amt eingeführt wurde, gelang es ihm, unter Donner und Blitz den Ort von diesem Unwesen zu befreien.
Mitgeteilt vom ehem. Bürgermeister A. Kittenhofer
Die rätselhafte Inschrift
Das mit hohen Treppengiebeln versehene Amtshaus in Windberg war früher ein Gasthaus und vor langer Zeit das Richteramtshaus. Im Hausflur befindet sich eine kleine Steintafel mit der Inschrift: Erbauet von Fundament Ao. 1175 erneuert 1728. Das Richteramtshaus ist ein wohl auf romanischer Grundlage errichteter Neubau von 1502 mit spätbarocken Veränderungen. Im Hausflur des Erdgeschosses hängt eine einfache Inschrifttafel aus Holz mit geheimnisvollen Großbuchstaben:
W.L.S.D.U.N.N.I.A.D.E.J.A.D.L.K.M.-O.R.R.R.G.I.H.U.D.B.K.-W.D.O.R.N.R.R.M. S.G.R.R.D. -1866. –
Nach der Tradition lautet die Auflösung: Wir leben so dahin und nehmens nicht in acht, daß ein jeder Augenblick das Leben kürzer macht.- O Richter, richte recht, Gott ist Herr und du bist Knecht – Wenn du, o Richter nicht recht richtest mich, so wird Gott recht richten dich.
Das nächtliche Kegelspiel auf dem Buchaberg
Mündlicher Überlieferung nach soll einst auf dem 600 Meter hohen Buchaberg zwischen Neukirchen und Windberg ein Raubritterschloß gewesen sein. Geschichtlich läßt sich das jedoch nicht nachweisen. Auf dem Buchsberg sind außer einigen Mauerresten in der Nähe der dortigen „Girglbauernkapelle“ keine weiteren Anzeichen vorhanden, die auf ein Schloß schließen ließen. Woher aber diese Mauerreste stammen, weiß niemand.
Im Volksmunde lebt die Sage, daß die Raubritter des Schlosses gar arge Gesellen waren. Sie haben das Volk unterdrückt und ausgeplündert. Vom christlichen Glauben und den Geboten Gottes wollten sie nichts wissen. Mit besonderer Vorliebe haben sie den Sonntag entheiligt. Statt in der Kirche des naheliegenden Prämonstratenserklosters der Messe beizuwohnen, haben die Ritter mit großem Krach und gräßlichem Lärm ein tolles Kegelspiel betrieben. Dieses gotteslästerliche Treiben wurde aber furchtbar bestraft. Bei einem Unwetter fuhr der Blitz in die Burg und vernichtete sie mit allen Insassen.
Den Rittern selbst Wurde aber noch eine weitere Strafe auferlegt. Sie mußten in gewissen Zeitabständen zur mitternächtlichen Geisterstunde ihr Kegelspiel fortsetzen. Oft hörten Einwohner dem Buchaberg naheliegender Höfe ein dumpfes schauerliches Rollen der Kegelkugeln, die ihnen Schrecken und Angst einflößte. So haben die Ritter selbst nach ihrem Tode keine Ruhe gefunden und mußten für ihre Sünden büßen.
Man erblickte noch lange in der Nähe der Kapelle manchmal gespenstische Wesen, das Grauen verursachte. Auch die Ritterfrauen mußten nach ihrem Tode büßen. Auf dem Spielberge jenseits des Buchaberges sah man öfters weibliche Gestalten umherwandeln.
1929 von Pfarrer Peter Poiger
Die Ritterburg auf dem Buchaberg
Hoch auf des Buchbergs Gipfel
Dort stand in alter Zeit
Die Burg von stolzen Rittern
Schaut’trutzig in die Weit‘.
Puchberger war ihr Name,
War ein gar stolz Geschlecht;
Sie dünkten sich erhaben
Hoch über alles Recht.
Der Raub und Jagdgelüste
Erfüllte ganz ihr Herz,
Am Tag und auch bei Nacht
Trieb man nur Spiel und Scherz.
Die Ritter und die Rappen
In ihrem Übermut,
Sie taten arg viel Unrecht
Dem Volk an Hab und Gut.
Und wenn die Glock— im Tale
Sie lud in Gottes Haus,
Verbrachten sie den Sonntag
Zu Spiel in Saus und Braus.
Der Herrgott in dem Himmel
Sah dieses gottlos‘ Spiel;
Er macht ihm bald ein Ende,
Der Frevel war zu viel.
Es war zu Sommerszeiten
Gewitterschwere Nacht:
Da zuckt ein Blitz vom Himmel,
Fuhr in die Burg mit macht.
Bald loderts hell in Flammen
Hinauf zu des Himmels Höh’n.-
Die ganze Burg in Flammen!
Wie war das wild und schön!
Von all der stolzen Größ‘
Findst du jetzt nur die Spur:
Die Mauern und die Steine
Sind Überreste nur.
Die Strafe war gerecht,
Die diese Ritter traf;
Denn allzeit hat‘s geheißen,
Daß Übermut heischt Straf!
Selbst nach ihrem Tode
Die Ruh sie fanden nicht;
Zu groß war ja ihr Frevel,
Zu schwer der Sünd‘ Gewicht.
Noch vor nicht langen Zeiten
Zur mitternächtiger Stund‘,
Tat sich im Tal ein Lärmen
Vom Berg herunter kund.
Wenn andre Menschen ruhten
Von ihren Sünden aus –
Die Ritter mußten geistern
Dort, wo einst stand ihr Haus.
Als ob die Kugel rollet
Auf einer Kegelbahn,
So hört sich das Getöse
Im Tal herunten an.
Jenseits vom Bergesgipfel,
Spielberg vom Volk benannt,
Sah man oft Fräuleins wandeln
Im ritterlich‘ Gewand.
Jetzt schein die Straf geendet,
Gebüßt ihr böses Tun;
Man hört nicht mehr das Lärmen;
Die Ritter dürfen ruhn.
Pfarrer P. Poiger
Bei meinen heimatgeschichtlichen Nachforschungen habe ich herausgefunden, daß es in der Nähe von Cham einen Buchberg gibt, auf dem früher tatsächlich eine Burg stand. Sie war im Besitz des mächtigen Geschlechts der Buchberger (auch Puchberger).
Da Pfarrer Peter Poiger, von 1910 bis 1934 Seelsorger der Pfarrei Neukirchen, vorher in Chammünster Geistlicher war, hat er sein Gedicht dem Buchberg bei Cham und nicht dem Buchaberg zwischen Neukirchen und Windberg gewidmet.
Kornel Klar
Windberger Hexentisch
Als der Aufhebungskommissar Baron Limpöck, Landrichter von Straubing, 1803 im Kloster Windberg tätig war, fand er einen Hexentisch vor, auf dem die „Hexenleuth hl. Hostien grausam mißhandelt mit einer Schuech-Ahl und einem Hammer“. Limpöck ging der Sache nach und kam zum folgendem Ergebnis: Eine Häuslerfamilie namens Grueber zu Geißling im Gericht Pfatter wollte 1689 bei einer Nachbarsfamilie unbedingt etwas durchsetzen. Sie wollte zugunsten der Gruebers eine Aussage machen. Aber die Leute waren nicht dazu zu bewegen. Da griffen die Gruebers zu anderen Mitteln. Zuerst gaben sie vor, eine arme Seele sei ihnen erschienen, die sich für ihre Sache einsetzte, und als das auch nicht half, suchten sie durch eine Hostienschändung sich die Hilfe Satans zu verschaffen. Sie entwendeten eine hl. Hostie und mißhandelten sie auf einem Tisch durch Stechen und Hämmern.
Ob es etwas nützte, ist zweifelhaft. Die Sache kam auf, sie beschäftigte die Regierungskommission, die ihre Siegel auf dem Tisch anbrachte. Die Gruebers kamen vor Gericht, das die ganze Angelegenheit „malefizisch“ behandelte. Hans Grueber und seine Frau Gertraudt, sein Bruder Benedikt Egger und dessen Weib Elspet wurden nun „an einer saul ertroßlet“ wegen Beleidigung der göttlichen Majestät und deren Ableugnung, sowie Anbetung des Teufels, erschrökhliche Verunehrung des hochw. Guettes“ und anderer Schandthaten der Hexerey. Katharina und Balthasar, weitere Geschwister Hans Gruebers wurden mit dem Schwert hingerichtet und die Körper sodann verbrannt. Die Grueberschen Kinder – die sicher an der ganzen Sache unschuldig waren – mußten auf der Richtstatt der Exekution zusehen und wurden dann „im Amtshaus empfindlich mit Ruthen gezüchtiget.“
Das Kloster Windberg erwarb 1770 diesen Tisch und hätte ihn gern zu einem Wallfahrtsziel gemacht. Es wäre eine Konkurrenz zur Deggendorfer „Gnad“ geworden. Aber die fortschreitende Aufklärung ließ es nicht mehr so weit kommen. Für den Aufhebungskommissär war der Tisch jedenfalls 1803 ein großes Ärgernis. Er schickte ihn auf Wunsch der General-Landesdirektion am 24.7.1803 nach München, wo er vernichtet wurde. Das 19.Jahrhundert hatte für dergleichen Dinge – die Schandtaten der Gruebers und die dafür verhängten Strafen – nicht mehr viel übrig.
P. Dr. Norbert Backmund
Der Schustergeselle und der Tod
In der niedrigen Werkstatt des Schuhmachermeisters Lickleder sitzen mit dem Meister die drei Gesellen und der Lehrling an ihren niedrigen Tischen bei zuckendem Licht der Petroleumlampe und arbeiten schweigsam. Es ist bereits nach zehn Uhr – aber für den nächsten Markt in Schwarzach müssen noch etliche Paar Schuhe fertig werden. Deshalb arbeiten sie so spät in die Nacht hinein. Sepp, der mittlere Geselle, ist ein sehr ernster Bursche, der sein Fach versteht. Für sein Alter von 22 Jahren ist er eigentlich zu ernst. Man sieht ihn auf keinem Tanzboden, auf keiner Unterhaltung. Sonntags sitzt er über alten Büchern und liest.
Heute ist er etwas wunderlich. Immer wieder setzt er die Arbeit aus und lauscht etwas. Jetzt legt er den halbfertigen Schuh nieder und geht hinaus. Nach kurzer Zeit kommt er wieder schweigsam in die Werkstatt. Der Meister bemerkt sofort, daß Sepp etwas zugestoßen sein muß, denn er ist kreideweiß im Gesicht. Er fragt ihn daher: „Sepp, bist du krank? Du bist ja käseweiß im Gesicht.“ „Nein“ antwortet der Sepp einsilbig. „Ist dir etwas zugestoßen?“ fragt der Meister weiter. Als der Meister mit seinen Fragen nicht aufhört, sagt der Geselle schließlich:“Wenn der Meister mir gar keine Ruhe läßt, so muß ich es ihm doch sagen. Als ich vorhin draußen war, da schaute ich zufällig zu unserem Fenster. Ich sah eine weiße Gestalt, die bereits mit dem Kopfe in unserer Schlafstube war und dann ganz hineingestiegen ist. Diese Gestalt war nur der Tod. Ich meine, Meister, wir sollten uns alle gut zusammennehmen, denn der Besuch des Todes hat sicherlich nichts Gutes zu bedeuten.“
Der Meister und die Gesellen, die eigentlich richtige Raufbolden waren, lachten über Sepp. Vierzehn Tage nachher erkrankte der Lehrling und einige Tage darauf starb er auch. So hat der Sepp tatsächlich die Voranmeldung des Todes gesehen, wie er stets fest und entschieden behauptete.
Niedergeschrieben von OLin. Englhart
Die Girglbauern-Kapelle
Auf dem Waldweg von Unterbucha nach Neukirchen steht seit unvordenklichen Zeiten eine einfache Waldkapelle. Früher soll sie weiter unten gestanden haben. Dorthin kamen oft aus weiter Ferne fromme Pilger. Manche schleppten sogar ein schweres hölzernes Kreuz – vor 100 Jahren lehnten noch solche an der Kapelle. In der Kapelle ist ein Opferstock, die eingelegten Gelder dienten zur Celebration von hl. Messen in Neukirchen. Die Kapelle heißt auch Girglbauern-Kapelle. Früher befand sich ein schwarzes Kruzifix in der Kapelle, das bei einem Brande im Kloster Windberg auf mirakulöse Weise gerettet und hierher verbracht worden sei. Es würde aber geraubt und durch ein angeschwärztes ersetzt. In der Kapelle befindet sich die Holzfigur der Hl. Apollonia, der Helferin gegen Halsschmerzen.
Unterhalb der Kapelle befindet sich eine Wolfsgrube zum Abfangen des Bauernschreckens in früherer Zeit.
Niedergeschrieben von OLin. Maria Englhart.
Maria hat geholfen
Es war in Jahre 1670; da sah der Knabe Matthias Schmoll aus Windberg einen roten Adamsapfel an einem Nußbaum prangen. Er stieg sofort auf den Baum, um den Apfel zu holen. In seinem kindlichen Übermut wagte er sich weit auf die dünnen Ästchen, die seine Last nicht aushalten konnten. Die Zweiglein brachen und Matthias stürzte in die Tiefe. In dem unteren Gezweige blieb er wieder hängen und schrie um Hilfe. Er selbst durfte sich nicht rühren, denn sonst wäre er sicherlich abgestürzt.
Es liefen Menschen herbei , doch sie konnten ihm nicht helfen, da keine entsprechend lange Leiter zu finden war. In seiner großen Not erblickte der Junge vor sich die Gnadenkirche auf dem Bogenberg. Er wußte auch, daß das Gnadenbild schon unzähligen Menschen geholfen hatte, die inbrünstig um Hilfe flehten. Da bat er innigst, die Gottesmutter möchte ihn in ihrem Schoße auffangen. Als er die Bitte geäußert hatte, schloß er die Augen und ließ sich vom Baume herunterfallen. Zur Verwunderung aller Umstehenden ist Matthias von einer vielklafterigen Höhe wohlbehütet auf dem Erdboden gelandet.
Die Gottesmutter Maria hatte unsichtbar ihren Schoß ausgebreitet und das Kind aufgefangen.
Niedergeschrieben von OLin. Englhart
Der Bogner Jackl von Windberg
Der verstorbene Bogner Jackl und sein Weib Fanny, Gott hab sie selig, waren noch Leute vom alten Schlag, an denen alle Errungenschaften der modernen Zivilisation und Kultur abprallten. Sie wohnten in der ehem. Klosterziegelei und bewirtschafteten etwa acht Tagwerk Grund. Obwohl sie Kühe hatten, so trugen oder radelten sie mit dem Schubkarren die gesamte Ernte nach Hause. Sie wollten die Kühe schonen, damit sie mehr Milch geben. Es ist selbstverständlich, daß der Jackl und sein Weib den anderen in der Arbeit stets nachhinkten. Eines Sommers hatten die anderen ihr Getreide bereits zu Hause im Stadel, als Regenwetter einfiel. Der Hafer lag noch ruhig und ungestört auf dem Felde. Es regnete in Strömen und es schien, als würde es nie mehr aufhören. Die Burschen im Dorfe wußten wohl, daß Jackls Hafer noch auf dem Felde ungeschnitten war und nahmen sich vor, dem Jackl den Fleiß auf lustige Weise beizubringen. Jackl selbst war auch ein ganz fideler Kerl, der so manchen Spaß verstand. Es war in Meidendorf eine Hochzeitsfeier und die Burschen kehrten spät in der Nacht nach Windberg zurück. Ihr Weg führte sie an Jackls Haus vorbei. Sie klopften an das Fenster und riefen: „Wohnt hier der Bogner Jackl?“ „Ja, der wohnt hier“ kam die Antwort zurück. „Hier ist die Gendamerie aus Bogen“, sagten die Burschen mit verstellter Stimme. „Wenn sie bis morgen Abend ihren Hafer nicht eingebracht haben, werden wir sie verhaften, verstanden!“ Jackl schwieg und fand keinen richtigen Schlaf mehr, als die Burschen weggegangen waren. Am nächsten Morgen hingen die Wolken noch immer tief und es regnete. Doch der Regen konnte Jackl und seine Fanny nicht abhalten, den Hafer zu schneiden und auf ihrem Rücken einzubringen. Den ganzen Tag arbeiteten sie unermüdlich und brachten die Ernte heim.
Als es Abend wurde, hatte die „Gendamerie“ keinen Grund mehr, ihre Drohung auszuführen. Jackl und Fanny legten sich todmüde in die Federn. Die Burschen aber freuten sich an dem gelungenen Streich.
Niedergeschrieben von OLin. Englhart
Im Neukirchner Winkel und Mühlbachtal
Die Sage vom Nagelstein
Noch innerhalb des ehemaligen Gemeindegebietes von Obermühlbach, rechts der Straße nach Grün, liegt der sagenumwobene Nagelstein. Verläßt man die Straße, so überquert man vorerst einen schmalen Waldpfad, den „Klosterweg“. Diesen Weg haben in den vergangenen Jahrhunderten viele Grunduntertanen des Klosters Windberg beschritten, wenn sie aus der Englmarer Gegend nach dem Pämonstratenserstiftwollten. Wenige Schritte von dem Klosterweg entfernt befindet sich ein mächtiger Fels, der jäh in eine wilde Bergschlucht abfällt. Das ist der Nagelstein. Mit ihm ist eine Sage verbunden. Sie will wissen, daß im Mittelalter in der Bachschlucht ein mächtiger Tatzelwurm, ein Drache, gelebt hat. Diesem gefährlichen Untier fielen alljährlich viele Menschen zum Opfer, und es stellte eine wahre Plage für die Umgebung dar. Es fand sich aber weder Bauer noch Ritter bereit, den Kampf mit dem Drachen aufzunehmen. Als die Angst immer größer geworden war, entschloß sich der beherzte Klosterjäger von Windberg, den Drachen zu töten und die Gegend von dem Untier zu befreien. Da der Ausgang des Kampfes nicht abzusehen war, ging der Klosterjäger vorsichtshalber zu den Sakramenten. Durch die hl.  Kommunion gestärkt, auf Gott und seine Waffen vertrauend, nahm der mutige Jäger den ungleichen Kampf auf. Es gelang ihm, den Drachen zu töten und die Gegend von dem Schrecken zu befreien.
Kommunion gestärkt, auf Gott und seine Waffen vertrauend, nahm der mutige Jäger den ungleichen Kampf auf. Es gelang ihm, den Drachen zu töten und die Gegend von dem Schrecken zu befreien.
Zur Erinnerung an diese mutige Tat wurde in der Folgezeit alljährlich zur Sonnenwende das Nagelsteinerfest gefeiert. Wie hoch dieses Fest in Ehren stand, beweist die Tatsache, daß der Baron vom Schloß Haggn jedesmal mit seiner Familie der Feierlichkeit beiwohnte. Seit mehr als einem Jahrhundert wird das Nagelsteinerfest nicht mehr gefeiert und geriet in Vergessenheit. Die Sage der Drachentötung lebt aber weiter im Volk, und der Nagelstein erfreut jeden Wanderer und Naturfreund durch seine wilde Schönheit.
Nach Pfarrer P. Poiger
Geschichten um den Nagelstein
Die frühere Gemeinde Obermühlbach, deren Landschaft und Struktur sich in den letzten hundert Jahren kaum verändert hat, besaß neben der Hammerschmiede und dem Bräuhaus nur noch einen für Wanderer und Sommerfrischler gleichermaßen interessanten Punkt – den Nagelstein. Von der heimischen Bevölkerung ward er zwar kaum gesehen und besucht, denn für die war er eher ein Ort der Finsternis statt des Licht. Nur die zünftigen Bayerwaldwanderer, wie etwa der unvergessene Justizrat Prager und seine Zeitgenossen aus Straubing, fanden schon immer den Weg in die Schlucht des Mitterberger Baches, die ein wenig an eine Klamm in den Gebirgstälern erinnert. Die Bezeichnung „Wasserfälle am Nagelstein“ ist allerdings ein wenig hoch gegriffen. Dafür aber gibt es eine Reihe von Sagen und Geschichten um diesen Felsen, den ein ewiges Rauschen des Baches und ein stetes Ächzen in den Baumwipfeln umgibt.
Als Kinder ist uns immer ein Schauer über den Rücken gelaufen, wenn wir vom Nagelstein in die Tiefe schauten; in den Bachgrund haben wir uns fast nie hinuntergetraut. Ein Schauer überfiel auch immer jenen einsamen Wanderer, der nachts am Nagelstein vorbei mußte, denn in dieser Gegend war es nicht geheuer, der Teufel hatte seinen Wohnsitz hier.
Da ist zunächst die Sage vom letzten Drachen im Bayerischen Wald, der hier zuhause war und der von den Grafen von Bogen mit einer Meute von Hunden und einem großen Jagdgefolge erlegt wurde. Pfarrer Peter Poiger von Neukirchen wußte diese Szene sehr anschaulich zu schildern. Meine Mutter hat zusätzlich noch immer von einer großen Schlange und einem Natternkönig erzählt, der die Menschen auf ihrem Weg nach Windberg bedroht und geängstigt hat.
Kein Wunder, daß sich an dieser Stelle auch Geister und Gespenster niederließen, die dann ängstlichen Menschen auch prompt in meist bedrohlichen Gestalten erschienen sind.
So hat mein eigener Onkel, der Zistler Michl von Hof, noch um die Jahrhundertwende am Nagelstein immer zwei wie Gendarmen gekleidete dunkle Gestalten am Straßenrand gesehen, zwischen denen er hindurch mußte. Wenn er seitwärts vorbei wollte, erhob sich dicht daneben ein großer schwarzer Hund, so daß er wieder auf die Straße zurückgetrieben wurde; er mußte zwischen diesen Gestalten hindurch. Von da ab lief er dann keuchend und schweißtriefend bis zu unserem Haus in Bachersgrub und klagte meinen Eltern, daß es ihn am Nagelstein „angeweihezt“ hat. Heimzu mußte ihn mein Vater bei der Nacht bis zur Hofer Säge begleiten, ehe er sich wieder außer Gefahr glaubte. Den großen schwarzen Hund sollen auch eine Reihe anderer Menschen gesehen haben, und außer dem Zistler Michl mußte mein Vater auch noch andere Freunde aus dem Raum Grün-Englmar bis zur Hofer Säge begleiten. Mein Vater selbst steckte sich nach Art der Holzfuhrleute ein langes Messer in die Tasche, ist aber nie auf einen Geist oder auf ein Gespenst gestoßen.
Andere Wanderer fanden mitten im Winter am hellichten Tage bei Neuschnee auf der Straße beim Nagelstein einen großen Haufen frischer und noch dampfender Pferdeäpfel, ohne daß im Schnee eine Wagenspur oder ein Pferdehuf sehen war. Also mußte der Teufel seine Notdurft hinterlassen haben.
In der Nähe des Nagelsteins, etwa gegenüber dem Sattler Anwesen, soll esam Fronleichnamsfest während des Johanni-Evangeliums immer geklingelt, geleuchtet und gefunkelt haben. Deshalb glaubten die Bewohner von Mitterberg, es wäre ein großer Goldschatz unter den Steinen vergraben, den der Teufel an diesem Tage immer zeigen müsse. Es traute sich aber niemand hin, und so verschwand der Schatz wieder im Erdboden. Manche munkelten sogar, das könnte der in Schwedenkrieg aus Oberalteich fortgebrachte Klosterschatz sein, den es aber wohl nie gegeben hat.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die neue Straße nach Grün gebaut. Die Bauleute hofften in dieser Gegend einen Haufen Geld oder Gold zu finden, doch damit war es nichts. Statt dessen versprachen sie ein Kreuz auf einen Stein zu setzen, wenn der Straßenbau in der verhexten Gegend um den Nagelstein ohne Unglücksfälle ablaufe. Das versprochene Kreuz ist heute noch zu sehen. Bei uns daheim ging die Sage, daß all kleinen Kinder von der Hebamme hinten beim Nagelstein geholt und in die einzelnen Höfe, Häuser und Hütten getragen werden. Ganz unten am Nagelsteinfelsen sollte eine Tür aus Stein in den Berg hineingehen, und da sollten die kleinen „Schrazen“ einfach herauskommen. Dazu ist zu sagen, daß damals in den meisten Familien, ob Bauer oder Häuslmann, jedes Jahr ein kleines Kind ankam, oftmals bis zu einem Dutzend und auch mehr. Aus Mangel an Sexualunterricht in der Schule suchten die Eltern nach einer plausiblen Erklärung für die vielen Kinder, und was lag da näher, als dem ohnehin verwunschenen Nagelstein das Urheberrecht an dem reichen Kindersegen zuzuschieben. Bei uns daheim hat das dazu geführt, daß einer meiner älteren Brüder sich mit der Axt hinter die Haustüre stellte und die Hebamme erschlagen wollte, als sie wieder Nachschub brachte. Schließlich war die Stube eh schon voller kleiner Kinder. Ich selbst war die Nummer zwölf.
Erzählt von Hans Kilger
Der Ochsentritt
Die Umgebung von Neukirchen zeigt stets andere Merkwürdigkeiten. Auf dem Fußwege von Neukirchen nach dem hochgelegenen Orte Niederhofen erblickt man unter einem Steinhaufen, auf einem Granitblock, die deutlich eingemeißelte Figur der Klaue eines Rindes, genannt der Ochsentritt.
Das Landvolk, das hinter allen rätselhaft vorkommenden Dingen gleich etwas Geisterhaftes erblickt, erklärt sich diesen Ochsentritt so, daß einmal der Teufel auf einem Ochsen über diesen Stein geritten sei, wobei eine Ochsenklaue im harten Stein ihren Abdruck hinterlassen habe.
Solche Ochsentritte sind auch in manchen anderen Orten, oft versteckt und unbemerkt, zu finden. In der Klosterkirche zu Windberg ist ebenfalls ein Ochsentritt zu sehen.
Solche Ochsentritte sind aber nichts anderes als alte Grenzsteine. In unserer Zeit kennzeichnet ein Kreuz am Stein die Grenze der Grundstücke. So war der Ochsentritt bei Neukirchen eine wichtige Grenze ehemaliger klösterlicher Besitzungen.
Von Pfarrer P. Poiger
Geschichten vom Perlbach
Die meisten Bäche des früheren Landkreises Bogen münden in die Donau. Fast alle werden in Volke Perlbäche genannt. Diesen Namen führen sie zurecht, denn früher fand man in Sande dieser klaren Bäche ganze Bänke von Muscheln, in denen hin und wieder eine kostbare Muschel verborgen lag. Heute sieht man nur mehr selten eine dieser Muscheln. Im Volke leben aber manche Geschichten um diese Perlmuscheln.
Der Galgensteg
Über den forellenreichen Bogenbach, die ehemalige keltische 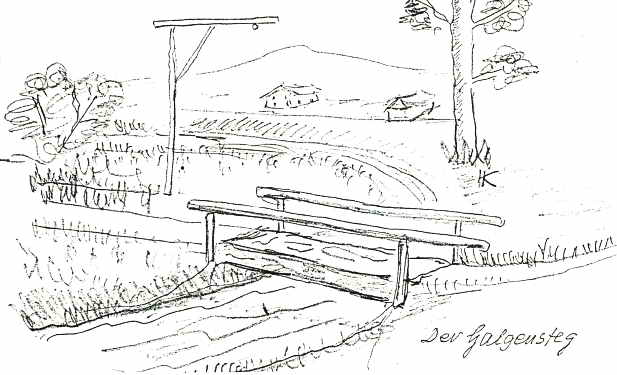 Pogana, die bei Bogen in die Donau mündet und die ehemalige Hofmark Haggn von Neukirchen trennt, führt ein steinernes Brücklein, genannt der Galgensteg. Der Bogenbach ist ein Perlbach, der noch vereinzelt Perlmuscheln führt. Die Perlfischerei war in früheren Zeiten ausschließliches Recht des Landesherrn. Eine so wertvolle Perle verleitete natürlich viele zum Perldiebstahl. Die Räuber aber wurden mit grausamen Mitteln bestraft, manchmal auch gehängt. Zur heilsamen Mahnung wurde an der beschriebenen Stelle ein sogenannter Schreckgalgen errichtet. Das Brücklein heißt heute noch der Galgensteg.
Pogana, die bei Bogen in die Donau mündet und die ehemalige Hofmark Haggn von Neukirchen trennt, führt ein steinernes Brücklein, genannt der Galgensteg. Der Bogenbach ist ein Perlbach, der noch vereinzelt Perlmuscheln führt. Die Perlfischerei war in früheren Zeiten ausschließliches Recht des Landesherrn. Eine so wertvolle Perle verleitete natürlich viele zum Perldiebstahl. Die Räuber aber wurden mit grausamen Mitteln bestraft, manchmal auch gehängt. Zur heilsamen Mahnung wurde an der beschriebenen Stelle ein sogenannter Schreckgalgen errichtet. Das Brücklein heißt heute noch der Galgensteg.
Perlen aus dem Perlbach
Unter dem Schloß Mitterfels rinnt ein Bächlein, das ist so schön wie eine Perle. Gar wenn die Sonne darüber steht, spielt das Wasser in allen Farben. Die Bäume treten in dem engen Tal so dicht an das. Ufer, daß sich ihre Zweige im Bach baden, und die Bäume trinken daraus. Ein großes Wasser hat der Bach nicht, aber gerade das macht ihn so freundlich und lieb. Niemand braucht seine Wellen zu fürchten, sie klatschen über die moosgrünen Steine oder spielen darum herum, schäumen ein wenig und sind gleich wieder sanft und klar wie ein Spiegel.
Der Bach ist nicht nur schön wie eine Perle, er brachte einst auch Perlen. Wenn man den alten Leuten glauben kann, müssen darin die Perlen sackweise gewachsen sein, so daß die Herren Kürfürsten ihren Frauen zu jedem Geburtstag ellenlange Perlketten um den Hals legen konnten.
Richtig ist, daß die Kurfürsten ihre Hand auf alle Waldbäche gelegt hatten. Außer ihren Fischern durfte niemand daraus eine Muschel, einen Fisch oder einen Krebs herausholen. Damals waren die Waldbäche reich an Fischen und Krebsen, und die Muscheln lagen stellenweise übereinander.
Aber was die Wässerchen an Perlen hervorbrachten, war auch sehr gering. Kaum die tausendste Muschel trug eine Perle, und unter hundert Perlen fand man selten mehr als zwei, die genügend groß waren und den schönen Glanz hatten, wie es für ein Schmuckstück notwendig ist. Die meisten Perlen waren trüb, grünlich oder schwärzlich und nicht viel größer als Stecknadelköpfe. Hätten also die Frauen der Kurfürsten auf die Perlen der Waldbäche warten müssen, so wären sie Zeit ihres Lebens zu keiner Halskette gekommen.
Man erzählt, daß die französischen Soldaten, die um 1800 in unserer Gegend waren, ganze Körbe voll Muscheln herausgeholt haben. Sie aßen sie statt der Austern, die es in ihrer Heimat gab. Und was damals geblieben ist, das haben die Buben herausgeholt; denn heute droht keinem mehr Leib- oder Todesstrafe.
Aus der „Jugendheimat“ von Oskar Döring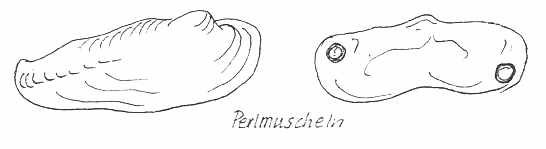
Der Schratzengang in Wachsenberg
Schratzengänge sind Erdhöhlen. Schratzen, menschenfreundliche und doch menschenscheue Wesen hausten darin. Gänge und Löcher von Schratzen finden wir im ganzen Bayerischen Wald, so in Autsdorf, bei der Kirche in Neukirchen und Wachsenberg.
So eine ausgedehnte, mit vielen Nischen und Seitengängen ausgestattete Erdhöhle ist auch in Unterwachsenberg zu finden. Das Dietl-Anwesen ist auf einem Schratzengang erbaut. In der „Fletz“ ist der Eingang zu dieser merkwürdigen Höhle. Bei einer Breite von ein bis zwei Metern und eine Höhe bis zu zwei Metern erreicht sie eine Länge von 15 Metern. Der in Sandstein gebaute Gang zeigt zu beiden Seiten kleinere und größere Nischen und einen großen Nebenraum. Heute dient dieses Schratzenloch als Keller.
Vor Zeiten wurden in der Höhle einige Tonscherben gefunden, denen man keine besondere Beachtung schenkte und so vielleicht ein Fund verloren ging, der uns über die geschichtliche Vergangenheit dieser Erdhöhle Auskunft gegeben hätte. Die Vermutung liegt nahe, daß diese Schratzenlöcher als Unterschlupf in Kriegszeiten gedient haben.
Die älteste Bewohnerin des Dietl-Anwesens, Franziska Dietl, konnte einige, wenn auch wenig glaubhafte Geschichten erzählen:
Die Glut
In früheren Jahren wollte eine Magd Kartoffeln aus dem Keller holen. Bald nach ihrem Einstieg in das einstige Schratzenloch kam sie ängstlich und ganz verstört aus der Höhle gekrochen. Aus ihren wirren Worten konnte man entnehmen, daß sie eine „Glut“, was einem Geiste gleichkam, gesehen habe. Eine anwesende Gänserupferin, eine beherzte Frau, wollte der Geschichte nachgehen, wurde aber von ihrer geängstigten Tochter zurückgehalten.
Einige dieser Gluterscheinungen, die auf das Vorkommen von Geld und Gold deuteten, bewogen die alte Frau Dietl, mit ihrem Vater Johann Kittenhofer nach Schätzen zu graben. Dabei entdeckten sie die beiden kleineren Zugänge zum großen Schratzenloch.
Beim Bau der Eisenbahnlinie Bogen-Cham kam oft ein Bahnarbeiter in die Erdhöhle und grub sich einen Kübel voll Sand. Dieser glänzte nämlich dermaßen, daß er an das Vorhandensein von Gold glaubte. Als aber die vielen Untersuchungen und Waschungen ergebnislos blieben; ließ er enttäuscht von seinen Goldgrabungen ab.
Nach Franziska Dietl
Der vergrabene Schatz
Zwei Arbeiter waren in Wachsenberg mit den Erdarbeiten für den Bau eines Stadels beschäftigt. Plötzlich stießen sie an einen dumpf klingenden Hohlraum. Überglücklich, glaubten sie einen vergrabenen Schatz entdeckt zu haben. In diesem Augenblick jedoch wurden die im Hofe stehenden Ochsen unruhig, so daß sie ihre Aufmerksamkeit dorthin lenkten. Im Hofe angekommen, waren die Tiere ruhig und gaben keinen Anlaß zur Beunruhigung. Etwas verdutzt kehrten sie an ihren Arbeitsplatz zurück und wollten sich mit Feuereifer der Ausgrabung des Schatzes widmen. Doch nicht wenig erstaunt mußten sie feststellen, daß jegliche Anhaltspunkte zu einem besonderen Fund geschwunden waren.
Nach Franziska Dietl
Girgl und Wastl auf Weltreise
Girgl und Wastl, Brüder aus Hungerzell, wollten sich eines Tages die Welt ansehen. Ihr Weg führte sie nach Oberwachsenberg an den sogenannten Katzlweiher. Dieser hatte einen klaren Wasserspiegel. Schafe weideten an den Ufern, die sich im Wasser spiegelten. So etwas hatten die Brüder noch nie in ihrem Leben gesehen.
„Wastl“, sagte plötzlich der Girgl, „da drinn san Schof“. „I siehg scho“ erwiderte der Girgl, „i steig jetza do eini und fang a Schof, und wenn i oans derwisch, da schrei i der, nacha steigst a einer und hilfst mas außa holn“. Indem der Girgl in den Weiher einsteigt, lurt der Wastl, ob er net schreit. Der Girgl aber hatte soviel Wasser geschluckt, daß er Gurgeltöne ausstieß wie ein Ertrinkender. Wastl mißverstand das und meinte, der Girgl rufe nach ihm und stieg ebenfalls in den Weiher.
Beide wären elendiglich ertrunken, wenn nicht vorübergehende Bauern sie aus dem Wasser gezogen hätten.
Nach Franziska Dietl
Der Sagenkranz des Bogenberges
Wie ein „Lug ins Land“ steht der Bogenberg vor dem Wald an der Donau, weit ausschauend: hin gegen Regensburg und Passau, über die Ebene und das Hügelland weg bis zu den Alpen. zurück in den Wall der böhmischen Berge. Auf seinem Gipfel prangt eine berühmte Wallfahrtskirche, die in früheren Jahren von Kaisern und Königen und unzähligen Pilgern heimgesucht wurde. Ehedem krönte den Bogenberg die stattliche Burg der Grafen von Bogen. Es ist uns recht herzlich wenig aufgeschrieben worden von diesem zu seiner Zeit so einflußreichen Geschlecht. Der Volksmund aber weiß noch manches zu berichten, was sich in alten Tagen zugetragen um und auf dem Bogenberg. Einzelne dieser Sagen werden manchem Leser schon bekannt sein.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Der erste Graf von Bogen
Es war die Zeit, da die wilden Horden der Hunnen in unserem Vaterlande die Städel leerten, das Vieh davonschleppten, die Leute erschlugen und die Häuser niederbrannten. Aus dem Kloster Oberalteich vertrieben sie die Mönche und hausten gar fürchterlich im Bogener Lande.
Da taten sich die Bürger in ganz Bayern zusammen, gingen zum Kaiser und klagten ihm ihre große Not. Der Kaiser, der ein guter Herr war, sandte Boten zu allen Grafen und Rittern des deutschen Landes und ließ ihnen sagen: „Kommt nach Regensburg! Da wollen wir beraten, wie die Hunnen zu vertreiben sind; weil es eine gar ernste Sache ist, darf jeder Edelmann zur Begleitung nur einen Knappen und einen Diener mitnehmen.“
Ein kaiserlicher Bote brachte die Einladung zum Reichstag auch nach Abensberg. Dort lebte Graf Babo, ein gar mächtiger Herr. Der hatte 32 Söhne, lauter kräftige und schöne junge Männer, auf die er stolz sein konnte. Er rüstete sie aus, wie der Kaiser es befohlen hatte, und zog mit ihnen gen Regensburg an den Hof des Kaisers.
Dort waren die Fürsten, Grafen und Ritter schon alle versammelt. Nur auf Graf Babo wartete der Kaiser noch, als in der Ferne eine dichte Staubwolke sichtbar ward. Der Herrscher wurde sehr ungehalten, als er das große Gefolge sah; zornig sprach er zu Babo:“Warum kommst du gleich mit hundert Mann? Habe ich nicht befohlen, nur mit wenig Dienern zu erscheinen?“ Da fiel Babo vor seinem kaiserlichen Herrn auf die Kniee und antwortete: „Sieh, mein gnädiger Herr, ich habe genau nach deinem Befehle gehandelt.“—“Wer aber sind die vielen anderen hier, mit denen du hergeritten gekommen bist?“ fragte der Kaiser. „Das sind meine Söhne; sie wollen deine Diener sein, mein Herr und Kaiser; ich empfehle sie deiner Huld und Gnade, und ich hoffe, daß sie treu mit Leib und Leben dir und dem Reiche dienen. Nimm sie in Gnaden von mir hin!“ Jetzt sprang der Kaiser freudig auf, umarmte Babo, dankte dem glücklichen Vater und rief jeden der 32 Söhne zu sich. Er küßte sie, behielt alle bei sich am Hofe und gab im Laufe der Zeit jedem ein Besitztum.
Zu Hartwig, dem kräftigsten und schönsten Ritter von ihnen aber sprach er. „Dir will ich das Schloß und die Grafschaft Bogen geben. Da kannst du wachen und mit deinen Mannen den wilden Hunnen fest aufpassen. Hüte mir das Land gut!“ Hartwig legte drei Finger auf des Kaisers Schwert, schwur ihm Treue bis zum Tod und zog ins Bogner Land. So wurde Hartwig, des Grafen von Babo von Abensberg Sohn, der erste Graf von Bogen.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Das Wappen der Grafen von Bogen
Der Graf von Bogen war schon recht alt geworden. Sein Sohn, ein junger schmucker Knappe, war des greisen Vaters Stolz. Der war der beste Schütze weit und breit; er konnte mit dem Pfeil jeden Vogel in Fluge schießen.
Eines Tages kam die Kunde nach Bogen: „Der Kaiser will in einer großen Schlacht die Hunnen aus dem Land treiben, daß sie das Wiederkommen vergessen.“ Ungern blieb der alte Graf daheim; aber er war schon zu gebrechlich, um in den Krieg ziehen zu können. Da bat der wackere Sohn: „Vater, laß mich gegen die Hunnen reiten!“ „Du bist noch viel zu jung und zu schwach, in dem großen Kampf zu fechten,“ widersprach der Vater. Der junge hörte nicht auf zu bitten, bis der Greis nachgab und ihn ziehen ließ. Mit Bogen und Pfeil und des Vaters Segen ausgerüstet, kam der furchtlose Reitersmann in Augsburg an.
Dort sah ihn der Kaiser und rief ihm scherzend zu: „Ei, junger Fant, du gehörst ja an der Mutter Schürze, nicht aufs Schlachtfeld; reit heim und warte, bis du groß und kräftig bist!“ Doch der junge Graf ließ sich nicht abtreiben. Der Bischof von Augsburg gab allen deutschen Kriegern den Segen und frohgemut zogen sie gegen die wilden Hunnen, der junge Bogener mit ihnen. Das war ein Morden und Stechen, gräßlich anzuschauen! Die Hunnen waren überlegen. Ihnen voran ritt ihr teuflischer Anführer, häßlicher als ein Gespenst, wilder denn der Satan. Schon wankten die Reihen der Deutschen. Da kam auf flinkem Rosse der junge Ritter von Bogen daher gesprengt, ein Pfeil surrte vom Bogen – mitten in des greulichen Hunnen Herz. Mit entsetztem Jammergeheul stoben die Ungarn zurück.
Doch schon raffte ein ungarischer Heidenpriester die Götzenfahne auf und eilte den fliehenden Hunnen voran, den Deutschen

entgegen. Wild wie kleine Teufel folgten die Hunnen. „Rache unserm Häuptling!“ brüllten sie und ein blutiges Gemetzel hob an. Da, plötzlich sank der Heidenpriester, von einem Pfeil getroffen zu Boden. Der junge Held hatte ihn niedergetreckt. Als die Hunnen ihre Fahne in den Blutstaub sinken sahen, wichen sie entsetzt zurück, sammelten sich aber gleich wieder und stürmten voll wilder Verzweiflung ein drittes Mal vor.
Das Glück schien ihnen hold zu sein. Der tapferste der Deutschen, Graf Konrad von Franken, fiel, zu Tode getroffen, von seinem Roß. Die Deutschen wichen schon der Übermacht, Da stürzte der junge Graf von Bogen sich in das Getümmel. Mit einem dritten Bogenschuß rächte er den deutschen Helden. Das war ein frohes

Aufjauchzen unter den Deutschen! Mit frischem Mut hieben sie auf die Hunnen ein und ruhten nicht eher, bis alle erschlagen waren.
Nach der Schlacht sammelte der Kaiser sein Heer um sich. „Wo ist der junge Reiter von Bogen?“ rief der Kaiser. Da trat dieser hervor. „Hoch dem jungen, wackeren Helden von Bogen; dreimal hat er uns mit seinem Pfeil die Schlacht gerettet!“ tönte es aus den Reihen der Kämpfer. Der reichte ihm die Hand, ließ ihn niederknien und schlug den jungen Mann vor aller Augen zum Ritter. „Dreimal hast du den Bogen zum Meisterschuß gespannt; drei Bogen sollst du von nun an im Wappen führen zum Andenken an deine Heldentat.“
Heiteren Mutes kehrte der junge Ritter zu den hocherfreuten Vater heim Seit dieser Begebenheit trugen die Bogener Grafen drei Bogen im Wappen.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Die Aswinstanne
Als die Hunnen aus dem Lande vertrieben waren, seit der Schlacht auf dem Lechfelde, wo der junge Ritter von Bogen so gut gezielt, ließen sie sich nicht mehr sehen, stand es gar nicht lange an, da kam den Deutschen ein anderer Feind: der Böhme. Nun sprach der Kaiser zum Grafen von Bogen, das war Graf Aswin, ein gar tapferer und starker Held!-:“Hüte mir die böhmische Grenze!“ Aswin baute Burgen dorthin und errichtete Wachttürme.
Einmal war ein recht gesegnetes Jahr. An einem schönen Herbsttag, da alle Feldfrüchte eingebracht waren, ritt Graf Aswin frohgemut von der Jagd heim. Er wollte sich gerade zu Tische setzen, als ein Reiter voll Staub und Schweiß durchs Tor gesprengt kam, zu Aswin lief und die Schreckenskunde brachte: „Die Böhmen sind über die Grenze geschritten; ihre Scharen sind so dicht, daß es in den Wäldern an der Grenze von böhmischen Räubern nur mehr wimmelt.“
Aswin ließ augenblicklich zum Kampfe blasen. Als er seine Knechte ausgerüstet hatte, kamen auch schon die Ritter von den umliegenden Burgen mit ihren Kriegern; sie hatten das Notfeuer auf den Wachttürmen gesehen und waren gleich nach Bogen aufgebrochen.
Andern Tags, als kaum der Morgen graute, zog ein tapferes Heer von Rittern unter Aswins Führung an die böhmische Grenze. Bei Kötzting stießen beide Heere zusammen. Es hub ein schweres Ringen an. Doch der Böhmenhaufen wurde von den gewaltigen Kämpfern Aswins in die Flucht geschlagen.
Aswin zog mit seinem Kriegern regenabwärts, um auf die Straße zu gelangen, die von Cham nach Straubing führt. An der Straße schlugen sie, weil die Nacht hereingebrochen war, ihr Lager auf. Als sie an Morgen aufbrechen wollten, waren sie von Böhmen umringt. Die Ritter mußten all ihren Mut und ihre ganze Kraft zusammennehmen, die Böhmen abermals in die Flucht zu schlagen. Bis zum Abend dauerte das wilde Ringen. „Jetzt werden sie das Wiederkommen vergessen,“ sprach Graf Aswin nach der Schlacht. Sie zogen noch bis an den Einfaltersberg, um da die Nacht zu verbringen.
Doch Graf Aswin hatte sich getäuscht, als er glaubte, die Böhmen kämen nicht mehr. Ein Böhmenanführer hatte wieder die zerstreuten Haufen seines Heeres gesammelt und überfiel Aswin ein drittes Mal. Die Schlacht wäre bald zum Schlimmen der Ritter ausgegangen, hätte nicht Aswin im letzten Augenblick noch mit verzweifeltem Mute den Anführer der Böhmen vom Pferd geworfen. Da flohen die Böhmen. Aber die Bogener ruhten nicht eher, bis alle Mannen des Feindes tot auf dem Schlachtfeld lagen.
Nur einige entkamen, die Schreckensnachricht in ihre Heimat zu tragen. Von der Stunde ward Graf Aswin nur mehr der Böhmenschreck geheißen. Die Böhmen aber kamen nie wieder.
Der Graf und die Ritter rasteten nach der heißen Schlacht am Alphaltersberg unter einer hohen Tanne. Plötzlich erhob sich Aswin, riß das Schwert aus der Scheide und hieb Kreuze in den Tannenbaum. „Zur Erinnerung an die Böhmenschlacht! sprach er.
Die Tanne wuchs fort und wurde Aswinstanne geheißen, bis ein Sturmwind den morschen Zeugen vergangener Heldentat brach. Alle Leute wissen noch von ihr zu erzählen.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Graf Aswins Tanne v. Adalbert Müller
Die Königin des Waldes, die Tochter alter Zeit,
Es ist Graf Aswins Tanne, mit Feindesblut geweiht.
Wohl schaut sie hoch und herrlich, hinein ins Böhmerland
und sagt den Tschechen drüben, wer hier sie überwand.
Einst lag im Regengaue von Sommerglut gereift
Der Felder reicher Segen in Garben aufgehäuft.
Das sah der Tschechenherzog und stieß sogleich ins Horn;
Es wuchs in seinen Feldern dem Hungerer kein Korn.
Stracks wimmelten die Räuber hervor aus Wald und Schlucht
Und schleppten in die Fremde des deutschen Bodens Frucht.
Doch wachte treu Graf Aswin auf seinem hohen Schloß;
Der Tschechenfrewlers Schatten sein männlich Herz verdroß.
„Wie, ist der Deutschen Schlachtmut erstorben und verweht,
Daß Fremde straflos ernten, was deutsche Hand gesät?
Sind unsre Klingen rostig, ist unsre Kraft erlahmt?“
Er ruft’s und seine Wange vor edlem Zürnen flammt.
Und seinen Ritterscharen sprengt mutig er voran;
Sie stürzen auf die Feinde, zehn gegen hundert Mann.
In Lüften saust die Lanze, es blitzt der Schwerter Stahl,
Bald trieft von rotem Blute das Gras im Regental.
Das Beste tut im Kampfe das edle Grafenbild;
Von seiner Streitaxt Hieben zersplittern Helm und Schild.
Ein Wall von Leichen türmt sich rund um den Helden her;
Die Feinde zagen, wanken – bald steht kein Rühme mehr.
Und drauf und dran die Mannen mit lautem Siegesruf;
Was nicht die Schwerter würgen, zermalmt der Rosse Huf.
Fortan kein Tschechenfalke herab ins Bayern stieß;
Graf Aswin nun und immer der Schreck der Böhmen hieß.
An einer hohen Tanne der wackre Kämpe stand
Und schaute übers Schlachtfeld herab vom Hügelrand.
Und seine blut’ge Streitaxt ergriff er siegesstolz
und hieb mit starken Schlägen drei Kreuzlein in das Holz.
So ward zum Siegesdenkmal die Tanne eingeweiht;
Noch grünt sie frisch und kräftig wie in der alten Zeit.
Denn Axt und Säge meiden den Stamm mit frommer Scheu,
Und selbst der Stürme Toben knickt keinen Ast entzwei.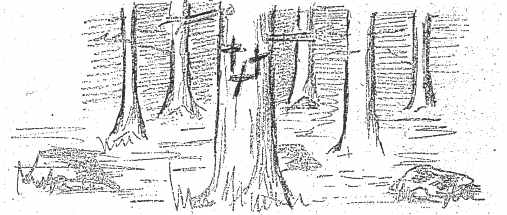
Die Riesenkerze auf dem Berg
Am Pfingstsonntag jeden Jahres bringen die Bewohner von Holzkirchen eine 13 Meter lange Kerze nach Bogen, die sie von da weg aufrechtstehend auf den Berg tragen.
Es war vor weit über vierhundert Jahren, da ging über die Fluren von Holzkirchen ein schauerliches Hagelwetter und zerschlug nicht nur Getreide und Feldfrüchte, sondern auch die Bäume in den Obstgärten und Wäldern. Die reichen Holzkirchner Bauern waren arm geworden. Nochmal so ein Schauer und sie müßten betteln gehen. Da kam ein Bürger auf den Gedanken, zu Maria auf dem Bogenberg eine Bittprozession zu machen, ihr eine große Kerze zu opfern und sie um Schonung ihrer Gemeinde zu bitten. Um ihr Flehen der Mutter Gottes recht sichtbar zu machen, brachten sie eine Kerze von noch nicht gesehener Länge auf den Bogenberg. Droben taten sie das Versprechen, alle Jahre eine solche Wachsstange zu opfern. Seither blieben sie vom Hagel verschont.
Als in Zeiten der Not die Holzkirchner einmal den Brauch abschaffen wollten, vernichtete abermals ein Hagelschauer ihre Fluren, sodaß sie im selben Jahre noch ihr gebrochenes Gelöbnis erfüllten und seither die Kerze in die Wallfahrtskirche auf den Berg tragen.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Das Gnadenbild
Graf Aswin war ein friedliebender und frommer Herrscher. Saß er einmal bei Hofe mit den Rittern und Herren aus der Umgebung. Alle waren lustig und guter Dinge, als der Torwärter hereintrat und dem Grafen meldete: „Herr, draußen wartet ein Bogener Bürger, der hat euch recht Wichtiges zu sagen.“ Aswin sprach:“Laß ihn nur herein!“ Der biedere Mann war ganz außer Atem und berichtete: „Denkt euch, Herr, ein Wunder hat sich zugetragen! Saßen meine Frau und ich auf der Hausbank und schauten in die fruchtbare Gegend über die Donau hinaus. Da zeigt meine Frau auf das Wasser, ich schaue hin und sehe es auch; es ist ein Muttergottesbild, höher als der Tisch da, muß aus Stein sein, und hört nur: das steinerne Bild kam gegen den Strom auf der Donau geschwommen. Auf einmal bleibt es stehen auf dem Stein, der aus dem Strudel schaut; ihr wißt ihn schon, Herr Graf!“
Aswin eilte auf den Turm und blickte hinab. Da standen die Leute dichtgedrängt am Ufer und schauten auf den Stein. Der Graf lief in seine Schloßkapelle, kniete nieder und sprach zum lieben Gott: „Du hast mir ein Wunderbildnis geschickt, daß es allda wohne. Soll ich an das Wunder glauben und deinen Willen erkennen, o Herr, daß es auf dem Bogenberg geehrt sein soll, dann zeig mirs deutlicher, Allmächtiger! Ich will auf meinem Rappen den steilen Abhang des Berges dreimal hinunter und heraufreiten; so mir nichts zustoßet, glaube ich an das Wunder und beherberge Unsere liebe Frau in dieser Kapelle.“ Der Graf ließ satteln und ritt dreimal den grausigen Ritt, ohne Hals und Bein zu brechen. Da eilte er nach Oberalteich, holte den Abt und die Mönche und ließ in feierlicher Prozession das Bild auf den Berg tragen und in der Schloßkapelle aufstellen.
Weil aber die wunderbare Ankunft des Steinbildes bald im Lande bekannt war, kamen aus allen Gegenden Pilger und siehe – ihr Gebet ward nie umsonst getan. Die Schloßkapelle wurde zu klein, so viele Wallfahrer zu fassen. Graf Aswin schenkte seine Burg dem Kloster Oberalteich und baute seine Wohnung auf den Schloßberg. Dorthin aber, wo vordem das stattliche Schloß stand, bauten die Mönche eine schöne Wallfahrtskirche.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Ludmilla
Sie war des Grafen Albert Gemahlin. Als dieser starb, war Ludmilla erst dreißig Jahre alt, eine in ganzen Land wegen ihrer Schönheit bekannte Frau. Sie lebte als Witwe auf dem Schloßberg in Bogen.
Da trug sich zu, daß Herzog Ludwig von Bayern längere Zeit in Landau an der Isar war. Er hatte schon oft en der reizenden Gräfin auf dem Bogenberg reden hören. An einem schönen Tag ritt er nach Bogen wallfahrten und suchte Ludmilla auf. Er wurde von ihrer lieblichen Schönheit und ihren hohen Tugenden hingerissen. Aber auch die liebenswürdige Frau war dem Herzog von Herzen zugetan. Hochbeglückt nahm Ludwig Abschied, um bald wieder zu kommen. Der Herzog hielt sich jetzt länger in Bogen auf als in Landau.
So kam es, daß den fürstlichen Bewunderer die lodernde Leidenschaft ergriff und in traulicher Stunde enthüllte er der Gräfin sein Fühlen und Verlangen. Ludmilla aber wies sein Drängen züchtig zurück; nur als Gattin wollte sie
sein Eigen sein. Da des Herzogs Bitten immer stürmischer wurden, gab sie scheinbar nach und bestimmte ihm den Tag, an dem er sie wieder besuchen dürfe.
In ihrer Sorgfalt fragte die Bedrängte den alten Hofmann, der ihr sonst schon so oft mit gutem Rat beigestanden. Der schlaue Alte ward nicht verlegen und machte einen Vorschlag, der ihr Gefallen fand. Sie ließ sich auf einen Leinenvorhang drei geharnischte Ritter recht naturgetrau malen und stellte an dem Tage, da Herzog kommen sollte, drei wirkliche Ritter als Zeugen ihres Unterredens dahinter.
Ludwig erschien und drang mit frohem Ungestüm auf die Erfüllung 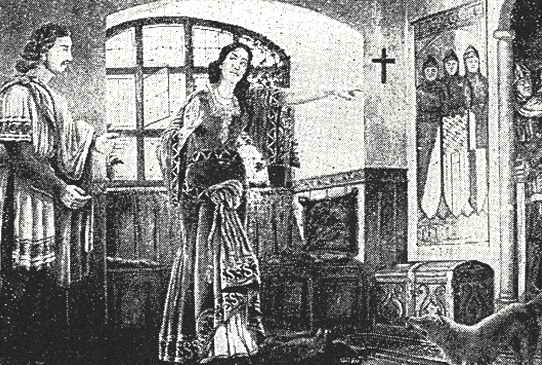 des Versprechens. Da führte ihn Ludmilla vor die Leinwand und sprach, von Rot übergossen, auf die drei Ritter an der Leinwand deutend: „Wenn ihr mir bei dem Zeugnisse dieser drei Männer schwört, daß ihr mich von jetzt an als eure Frau und Gemahlin anerkennen wollt, so will ich eure Wünsche erfüllen.“ Ludwig, ohne Harm, versprach’s. Da rollte der Vorhang herab, und vor ihm standen die drei Ritter aus Fleisch und Blut. „Ihr gestrengen Herren seid Zeugen dieses Vorgangs gewesen!“ redete Ludmilla sie an. Sie bezeugten: „Gnädigste Herrin, wir haben es wohl gehört.“
des Versprechens. Da führte ihn Ludmilla vor die Leinwand und sprach, von Rot übergossen, auf die drei Ritter an der Leinwand deutend: „Wenn ihr mir bei dem Zeugnisse dieser drei Männer schwört, daß ihr mich von jetzt an als eure Frau und Gemahlin anerkennen wollt, so will ich eure Wünsche erfüllen.“ Ludwig, ohne Harm, versprach’s. Da rollte der Vorhang herab, und vor ihm standen die drei Ritter aus Fleisch und Blut. „Ihr gestrengen Herren seid Zeugen dieses Vorgangs gewesen!“ redete Ludmilla sie an. Sie bezeugten: „Gnädigste Herrin, wir haben es wohl gehört.“
Da ward der Herzog gar unmutig und verließ, gekränkt von dem Mißtrauen der argwöhnischen Gräfin, sofort Schloß und Berg und ritt, von Herzeleid geplagt, außer Landes. Umsonst wartete die Gräfin: Ludwig blieb aus. Doch der verliebte Herzog konnte das Bild der holden Gräfin nicht los werden. So schwand, wenn auch langsam, der Groll.
Da mußte er – es war schon fast über ein Jahr verflossen – wieder nach Landau. Als der Herzog den Bogenberg sah, der ihm zu winken schien, konnte er nicht widerstehen. Frohen Herzens ritt er durch das Tor des Schloßberges und bat die entzückte Gräfin um ihre Hand. Sie folgte ihm als seine Gattin, wurde Mutter Herzog Ottos des Erlauchten und so Stammherrin der langen Reihe von Wittelsbachern, die bis vor kurzem unser Bayerlandes Geschick leiteten.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926.
Schimmelkapelle
Die Wälder auf den Bogenberg und die Wiesen ringsum gehörten dem Kloster Oberalteich. Auch der große Hutterhof war Eigentum der Klosterherren. Da hielten sie ihre Pferde. Tagsüber weideten die stattlichen Rosse auf den Wiesen zwischen Donau und Berg. In etwa 20 Meter Höhe am Bergabhang steht die Ulrichskapelle. Da wurde

alle Jahre am Tag des hl. Ulrich Messe gelesen.
An einem 4. Juli wurde wieder Gottesdienst gehalten. Es war ein schwüler Sommertag. Ein finsteres Gewitter drohte an Himmel. Rasch trachteten der Geistliche und die Andächtigen nach der Messe aus der Kapelle zu kommen, um vor Einbruch des Unwetters daheim zu sein. So vergaß in der Eile des Mesner die Türe zuzusperren. Sie blieb sperrangelweit offen.
Das Gewitter kam, Hagel und Regen sauste, vom Sturm gepeitscht, auf die Erde. Die Pferde auf der Weide nebenan wurden scheu und brachen durch die Umzäunung. Ein Schimmel flüchtete in die Ulrichskapelle. Kaum war er drinnen, da schlug ein Windstoß die Türe zu – der Schimmel war gefangen. Am nächsten Tag sperrte der Mesner die Türe zu, ohne in die Kapelle geblickt zu haben.
Andern Jahres am St. Ulrichstag fand man das Gerippe des verhungerten Tieres.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Die Entstehung der Klause
Das ist schon lange her. Da pilgerte der alte Hutterbauer auf den Berg, zu
beichten. Weil gerade Sonnabend war, ging er, nachdem er seine Sünden los war, nach Bogen ins Wirtshaus. Er nahm es nicht arg genau mit seinem Glauben. So soff er im Wirtshaus; es wurde finster,

(Fotos aus dem Heimatbuch von Bogen)
der Hutterbauer rauschig. Nach Mitternacht tat er das gotteslästerliche Wort: „Jetzt muß ich noch ein paar Maß hinunterschütten, damit sich der liebe Herrgott leichter liegt.“ Er blieb, bis der Tag anbrach. In der Frühmesse kniete er mit seinem Rausch an der Kommunionbank. Nach der Kirche wollte er heim. Da wurde ihm übel; er lehnte sich an einen Eichenbaum und erbrach sich. Er ward lahm und konnte das Bett nicht mehr verlassen.
Des Abends kam ein Bogenberger Mönch, der von einen Krankenbesuch zurückkehrte, an die Stelle. Vom Fuß des Baumes ging ein herrlicher Glanz aus, der ihn blendete. Er sah näher hin und erblickte die hl. Hostie, die so überirdisch strahlte. Mit flinken Beinen eilte er nach Oberalteich, dem Abte von den Wunder zu berichten. Schnell wurde die Geschichte bekannt. Die Mönche und die Bewohner Bogens begleiteten an anderen Sorgen in einer feierlichen Prozession den Abt an den Eichenbaum, die Hostie wurde in den Kelch gelegt und in die Wallfahrtskirche auf den Berg gebracht.
An die Stelle, wo das Wunder geschah, baute man eine Holzkapelle. Es kamen Kranke, Krüppel, und siehe – sie wurden gesund. Bald war es in ganzen Lande bekannt und viele Menschen pilgerten an die Wunderstätte.
Da ließ sich auch der lahme Hutterbauer in die Kapelle tragen, versprach dem Herrn, ein Kirchlein an Stelle der Holzkapelle zu bauen, wenn er ihm seinen Frevel verzeihe und ihn wieder gesund mache: der Hutterbauer konnte ohne Hilfe wieder heimgehen.
Von J. Weingärtner, Bogen, 1926
Der Oasiedl vo Bogn
Am Haus des ehem. Oberlehrers Fritz Schulz ist ein Fresko des Oasiedl von Bogen zu sehen, über den es ein Vers gibt: Der Oasiedl vo Bogn hat Sposcheitl klobn , und hat sich an Schiefling in’n A….einizogen. Der Mesner von Kreiling, a kreizbraver Mo, der hat eahm den Schiefling aus’m A….außa to.“ Du Mesner von Kreiling, du grundschlechter Mo, warum hast ma den Schiefling so schmerzhaft raus to?“ – „Du Oasiedl von Bogn, dös Schimpfa laß sein, sunst stecka da an Schiefling in A…. wieder nei!“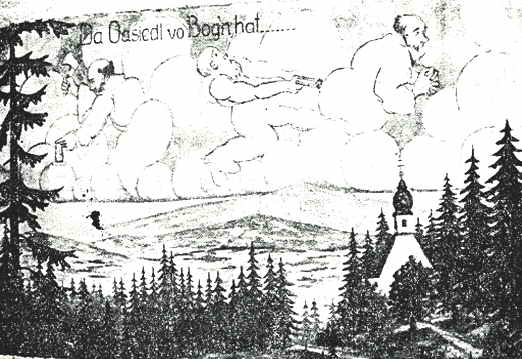
Der Abt Veit Höser
Als ein schwedisch-weimarisch Heer 1633 das Unheil des Dreißigjährigen Krieges in den Wald trug, fiel auch die Abtei Oberalteich dem heillosen Feind zur Beute. Die Kirche wurde von der Soldateska in einen Pferdestall, das Kloster in ein Zech- und Freudenhaus verwandelt. Die Mönche waren in alle Winde davongestoben, nur der Abt Veit Höser hielt sich in den nächsten Schlupfwinkeln des Waldes auf, das traurige Los seines Klosters zu beobachten.
Als der Prälat des Harrens und Bangens im Walde müde war, wagte er es, sich dem Kloster zu nahen. Er verkleidete sich just in einen Bauern und tat sogar ein Übriges, indem er ein Schweinchen an einem Stricke vor sich hertrieb. So kam er zu seinem Stifte, schon getrost, es nur wiedersehen zu können. Eben sprengten zwei schwedische Reiter, die nach Straubing beordert waren, aus dem Kloster. Nach den vielen Schmausereien schien dort bereits Schmalhans Küchenmeister geworden zu sein; denn als die Reiter den famosen Schweinetreiber erblickten, nahmen sie ihn ohne Umschweife mit, um in der nahen Stadt das Borstentier gewinnsüchtig für sich allein schlachten und zubereiten zu lassen.
Veit Höser fand die Wendung, die sein Wagnis nahm, bereits als sehr ungemütlich, noch mehr, als er an die Gefahr dachte, erkannt und wider oder mit Willen verraten zu werden. Es kam jedoch besser, als er befürchtete. Wohl ward er, als er von den Reitern über die Donaubrücke zu Straubing traben mußte, gleich von einem erkannt; aber es war der Metzger Hans Klaus, der eben durch das Tor herauskam. Hei, du guter, pfiffiger Hans Klaus, unverfroren redetest du den berühmten Abt an: „Sapperlot, G’vater, wos muaß ich den sehgn! Woaßt wohl nöd, daß der Olte an kloan Buam hot, der noch ‚m Voda schreit? Schau doch, daß dih ausloßn dö Herrn; nacha will ‚ih ja gern wieda ’n G’vater mocha!“
So sprach der biedere Metzger gar dreist und noch etliches zu den beiden Reitern: „Ihr Herren, das Schweinlin will ich schlachten und lecker zurichten, sogar eine Flasche Wein beisteuern, so ihr meinen lieben G’vatern loslaßt. Liegt doch, setzte er listig dazu, „ein jung Schwedenweib gesegneten Leibs in dem Haus und bedarf der Pflege nit weniger!“
„Blixem och Donner!“ raunten die beiden Schweden einander zu. „Ein Schlachtarfor Swien och ’n Butl Win? Stracks forta!“ riefen beide wie aus einem Munde dem Abte, dem das Herz pochte, zu. „Das schwedisch Frau ist din Glücka! Spring heim, du Hund, och sorga för!“
Sie riefen’s und der Abt eilte froh in eine der Gassen, indessen sich der brave Metzger anschickte, zu tun, was er den Schweden versprochen hatte um des vielbeliebten Abtes willen.
Nach Ludolf Silvanus
Die Schweden in Oberalteich
Im Kloster Alteich der Schwede war,
Trieb Unfug mit frecher Hand.
In Wäldern barg sich der Mönche Schar;
Drei Seelen nur hielten Stand:
Der Klosterfischer in heiler Luft,
Sein Maidlein bei Schrein und Ruh‘
Tief unter der Kirche in dumpfer Gruft,
Ein altes Mönchlein dazu.
Und alles kam in des Schweden Macht.
Der Fischer wies zitternd den Wein;
Sie soffen ihn in der Kirche zur Nacht
Bei loderndem Feuerschein.
Und sotten und brieten beim funkelndem Brand
Und gröhlten und fluchten dabei;
Ein Witzling steckte im Priestergewand,
Schlug Heiltum und Bildwerk entzwei.
Das tat dem alten Mönchlein gar weh;
Er lugte – und ’s Pförtlein knarrt.
Da riefen die Frewler ihr Werda, he!
Und haben den Alten beim Bart.
Und in der Tiefe wild jauchzte ein Mann;
Er brachte die blühende Maid.
Haus Gottes, du fülle mit Qualm dich an,
Wenn tiefste Schmach dich entweiht!
Doch sieh, die Jungfrau schrie gellend auf:
„Ihr Toten, ihr Toten erwacht!“
Da horch! Ein Geschnauf, Getös und Gelauf,
Geklirr wie nahende Schlacht!
Und Äbte mit Stäben und Ritter bewehrt
Und Mönche in grimmiger Wut,
Ein blitzendes Kreuz wie ein riesiges Schwert
Und Geißeln wie zuckende Glut!
Und wild in die Nacht lief der Feind hinein,
Und Kirche und Kloster waren frei.
Und wieder lagen die Toten im Schrein,
Vor Gott aber zitternd die Drei.
Wohl zog durch den Wald noch Heer auf Heer,
Mit ihnen Schrecken und Graus;
Doch kam kein Schwede nach Alteich mehr
Zu den Toten im Gotteshaus.
Nach Ludolf Silvanus
Am Totenmann
Eine halbe Stunde nordwestlich von Oberalteich schiebt bei Muckenwinkling ein niederer, bewaldeter Höhenzug, einer der letzten Ausläufer des Bayerischen Waldes, seine Endspitze, den Steinberg, ziemlich weit in die Ebene vor. In den Wäldern des Steinbergs hat sich früher gerne Diebs- und Raubgesindel aufgehalten. In der Nähe ist ein etwas abgelegener, düsterer Waldwinkel mit hohem Tannengehölz. Dieser Platz hat den Namen Am Totenmann. Niemand betritt den Platz ohne Scheu. „Dort scheut’s mi allamal!“ hört man die Holzsammler und Schwammerlsucher sagen. Hier hat sich vor langen Jahren einmal ein Mann erhängt, und seitdem sieht man oft einen Mann ohne Kopf wandeln. Auch hört man manchmal einen jämmerlichen Ruf; doch kann man nicht unterscheiden, ob es Höll oder Helfts! heißt. Sicher ist es aber eine Arme Seele, die hier umgehen muß.
Nach Emmi Böck
Der Durchsichtige
In Frammelsberg, einem Weiler der Gemeinde Degernbach, wohnte in einem sogenannten Inhäusl ein altes Weib mit seinem kranken Manne und seinem einzigen Buben. Das Weib, von den Leuten die Konabartlin genannt, war eine Wahrsagerin und Kartenschlägerin und konnte hexen und zaubern. Fast tagein, tagaus zog es im Bettel herum und der Junge begleitete es. Derselbe war aber auch der geeignetste Mitläufer; denn es besaß die Wundergabe, durch Brettern und Mauern zu sehen. Die Leute sagten fälschlich, er sei durchsichtig. Wenn die Konabartlin vor einer Tür anklopfte, konnte ihr der Bub schon sagen, wo die Bäuerin das Brot, die Eier, das Fleisch usw. verwahrt hielt. Auf diese Weise war es der Alten möglich, gar oft einen saftigen Bissen ungesehen in ihrem Tragkorbe verschwinden zu lassen. Die Wundereigenschaft des Knaben war bald bekannt geworden und es ließen ihn sogar Ärzte kommen, um ihn bei Patienten, die er durchschauen mußte, zu befragen, woran die Kranken litten. Als die Karmeliter von Straubing von ihm hörten, schickten sie zu ihm und versuchten, ihm den bösen Geist auszutreiben; denn nur ein solcher konnte nach ihrer Meinung in ihm stecken. Sie beeinträchtigten jedoch nur seine Gabe auf kurze Zeit; doch war der Junge von nun an nur mehr bei Neumond „durchsichtig.“
Nach Emmi Böck
Der Schmied Jakl z‘ Pfelling und die Bogner
Der Schmied Jakl z’Pfelling, einer der bekanntesten Raufer in der ganzen Gegend von dem man sagte, daß er allein schon öfter die ganzen Gäste, Bekannten, meistens Heuwischer einer Wirtschaft, versprengte, kam eines Tages mit mehreren Freunden nach Bogen. Wie gewöhnlich gab es gegen Abend eine Rauferei. Zerbrochene Bänke und Tische, zerhauene Maßkrüge, bedeckten den Boden des Biergartens. Bis der herbeigerufene Polizei angerückt kam, waren alle verschwunden. Nur der Schmied Jakl bleib mit blutigem Kopf auf dem Schlachtfeld. Beim gerichtlichen Nachspiel wurde er zu 20 Stockhieben, sofort vollziehbar, verdonnert. Der Jakl wurde bis auf die Hose entkleidet und über eine Bank gelegt. Beim 10. Schlag zerriß seine Haut und das Blut spritzte aus den Wunden. Nach dem 15.Schlag erbarmte sich der Landrichter und wollte ihm die weiteren fünf Schläge schenken. Doch der Jakl war zu stolz und forderte auch diese heraus mit dem Bemerken:. „I mag von enk Bogener nix geschenkt, ös notigen Bogener.“ Die weiteren fünf harten Schläge erduldete er mit zusammengebissenen Zähnen.
Nach einem Zeitungsbericht
Rund um den Degenberg
Die Sage von dem Geschlecht der Degenberger
Wenn man das Kommen und Gehen des Degenberger Reichsfreiherrengeschlechts, das Markt Schwarzach als Mittelpunkt ihres großen Machtbereichs auserkoren hatte, verfolgt, so muß man genau zwischen Geschichte und Sage unterscheiden. Während geschichtlich gesehen, das vornehme und mächtige Geschlecht derer zum Degenberg erst um 1130 unter Wolfram ! von Degenberg seine starke Burg auf dem über 600 m hohen Bergkegel nördlich von Schwarzach errichtete, war es vorher auf dem großen Maierhof in Schwarzach gesessen.
Nach der Sage aber wurde die Burg auf dem Degenberge bereits vor einem ganzen Jahrtausend aufgeführt. Ebenso gehen Sage und Geschichte bei der Zerstörung des Schlosses auf dem Degenberg getrennte Wege.
Es war in der Zeit der Ungarneinfälle im 10.Jahrhundert. Die Magyaren drangen dabei nicht nur in unser Land ein, sondern

unsere Ahnen gelangten auch in einzelnen Verfolgungen unversehens in das ungarische Gebiet. Bei solch einem Einfall lernte ein bajuwarischer Ritterssohn eine fremdländische Prinzessin kennen und entführte sie auf einem weißen Pferde. Die Königstochter hatte den jungen Recken lieben gelernt und folgte ihm. Die beiden lenkten ihr einziges Pferd donauaufwärts dem dunklen Waldgebirge des Bayerischen Waldes zu.
Das Paar errichtete sich auf einem Bergkegel eine Klause und lebte hier einfach und zufrieden. Innige Liebe verband ihre Herzen. Es war an der Stelle, wo sich später das Schloß Degenberg erheben sollte.
Der König aus dem fremden Reich brach mit einem großen Gefolge auf, nach dem verwegenen Ritter zu fahnden. Den Monarchen begleitete sein Leibarzt, der auch die Sterndeuterkunst verstand. Der Zug suchte sich mühsam seinen Weg und irrte lange Zeit vergeblich umher.
Eines Tages jagte der König in den dichten Waldbergen des Granitgebirges links der Donau einem Hirschen nach und kam dabei von dem Gefolge ab. Nach längerem Umherirren traf er in einer einfachen Hütte das so lange gesuchte Paar. Zornentbrannt wollte er den jungen Ritter sofort mit dem Schwerte töten.
Doch die Tochter wehrte ihrem Vater und bat flehentlich um das Leben ihres Mannes. Inzwischen waren auch die Gefolgsleute des Königs nachgekommen und der Sterndeuter sprach; „Die Sterne wiesen uns zum Ziel. Sie deuten aber auch an, daß dem Paar eine glückliche Zukunft beschieden ist. Wehe dem, der die Bande der Liebe gewaltsam zu trennen versuchen würde!“ So kam die Versöhnung zustande, die entsprechend gefeiert wurde.
Nach dem feierlichen Hochzeitsfest am Königshof unweit am großen Donauknie – der Gemahl der Prinzessin war nun auch vom königlichen Schwiegervater zum Ritter geschlagen – setzte sich von dort aus ein langer Zug von Reitern und Wagen in Bewegung. Ein Dutzend ausgewählter Ritterpferde und drei Wagen voll gemünzten Goldes waren dabei. Auf dem Berge, da zuerst die stille Klause gestanden, wurde alsdann durch königliche Gnad und Huld ein herrliches, großartiges Schloß aufgeführt. Der Ritter nannte sich „Freiherr von Degenberg“ und ward der Ahnherr des Degenbergischen Geschlechts.
In seinem Wappen hat er eine rotbekleidete Mannesbüste geführt, welche dem Aussehen eines bärtigen Türkenkopfes (Heiden- oder Ungarnkopfes) sehr ähnlich sieht. Dieser Kopf ist auch wieder im neu erstellten Marktwappen der Marktgemeinde Schwarzach aufgetaucht.
Von An. im Straubinger Tagblatt
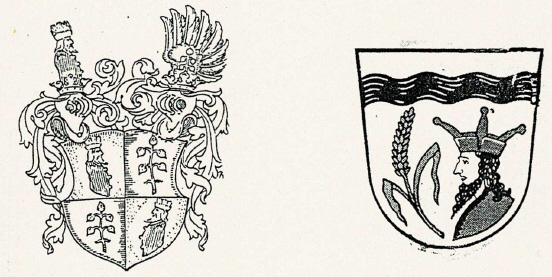
Mitschuldig am Tode der Bernauerin
Wie bei der Gründung der Burg Degenberg die Sage und die tatsächliche Geschichte getrennte Wege gehen, geschieht es auch bei der Zerstörung der Burg. Die tatsächliche Geschichte vom Untergang des Degenbergs ist genau so interessant wie die Sage; nur daß letztere augenblicklich aktueller erscheint, bringt sie doch damit den Tod der Agnes Bernauer, den diese 1435 in Straubing in den Fluten der Donau gefunden hat, in Zusammenhang.
Der Freiherr von Degenberg soll nämlich ein Mitschuldiger am Tode der schönen Augsburger Baderstochter gewesen sein. Ein vermummter Ritter – eben der Degenberger – soll mit einer langen Lanze die Agnes Bernauerin am Haar unter Wasser gehalten haben.
Das forderte natürlich Rache! So verlangte Herzog Albrecht – erst nach langen Jahren – zum Zeichen der Unterwürfigkeit, den Burgherrn von Degenberg auf, ihm, dem Herzog, auf einem mit vier Schimmeln bespannten Wagen ein Ei nach Straubing zu bringen. Dies tat der Degenberger nicht, sondern riet dem Herzog, es selbst zu holen! Da kamen Albrechts Truppen. Aber Steinruseln und Scheintürme brachten den Belagerern Verderben. Der Herzogs seine Machtlosigkeit einsehend, veranlaßte unter den listigen Vorwand der Versöhnung den Degenberger zu einer Reise nach Straubing. Hans von Degenberg nahm die Einladung an und freute sich seines Erfolges. Das brachte er auch bei seinem Abschied von seiner Gemahlin Elisabeth zum Ausdruck.
Sorgenvoll blickte Elisabeth, Freiin von Degenberg, ihrem Gemahl nach, als er sich zur Tür wandte. Wie fühlte sie sich nun wieder einsam nach den schrecklichen Tagen der vergangenen Wochen, ja wie fürchtete sie sich! Sie sehnte sich zurück auf die Grafenburg nach Ortenburg, wo sie die Jahre ihrer ersten Ehe verlebte. In ihrer Erinnerung sah sie sich plötzlich wieder als Tochter des Grafen von Törring gefreit. Wieviele Jahre waren aber schon wieder vergangen, seit sie Hans von Degenberg als Witwe des Grafen von Ortenburg gefolgt war? – Der Wind, der an den Fenstern rüttelte, schreckte sie aus ihrer Versunkenheit auf. Die Freiin fröstelte ein wenig, als sie sich zum Fenster begab. Dort unten ritt ihr Gemahl mit einem Edlen und grüßte nochmals herauf. Herzog Albrecht hatte ihn nach Straubing eingeladen, zu einem „großen Versöhnungsmahle“, wie es in der Botschaft hieß! Seit Herzog Sigmund so plötzlich auf die Mitregierung verzichtet hatte und Albrecht sich immer mehr Geltung zu verschaffen wußte, war die Ruhe nicht nur vom Degenberge, sondern aus dem ganzen Bayerischen Walde  entflohen. Hans von Degenberg hatte seinen Herzog auch dadurch erbittert, weil er sich dem Böcklerbunde angeschlossen hatte.
entflohen. Hans von Degenberg hatte seinen Herzog auch dadurch erbittert, weil er sich dem Böcklerbunde angeschlossen hatte.
Und was bedeutete das Gerücht um den gewaltsamen Wassertod der Augsburger Baderstochter, das seit Jahrzehnten noch nicht verstummt war? – Drohte Gefahr? – Aber die Burg auf dem Degenberg war fest; das hatten erst die vergangenen Wochen bewiesen! Ob Hans von Degenberg auch der List des Herzogs gewachsen war? – Mit solchen und ähnlichen Gedankengängen ließ Frau Elisabeth ihr weißes Tuch zum gewölbten Schloßfenster hinausflattern, bis der Reitertrupp hinter dem kleinen Schloß Edersdorf verschwunden war.
Gerade, als die Freiin sich in den kleinen Garten begeben wollte, kam ihr wieder der unsympathische Torwart Veihelsteiner in den Weg. Unterwürfig grüßte dieser; doch sie beachtete ihn gar nicht. Kaum war Frau Elisabeth aber an ihm vorbei, so zeigte sein Gesicht einen finsteren Ausdruck und seine Augen loderten vor Gier. Was sollte dies bedeuten? War er ein Judas unter den Getreuen seines Herrn?
Sein Herr aber ritt unterdessen besten Mutes gen Straubing. Nach schnellem Ritte gelangte er in die Herzogsstadt an der Donau an. Vor dem Mahle noch wollte ihn ein fremder Ritter warnen, doch durch den Empfang und das lächelnde Gesicht des Herzogs hatte Hans dies längst vergessen. In den späten Abendstunden, nach dem Mahle, erhob sich plötzlich Herzog Albrecht und deutete mit der Hand zum Fenster, welches trefflich den Blick nach Nordosten freigab, und Hans drängte es unwillkürlich, nach seiner Burg Ausschau zu halten, trotz der dunklen Nacht. – Doch, was war das? Da brannte es ja, da brannte seine Burg, sein Degenberg! Voll tiefem Schmerz rief er: „Mein Gott! Meine Frau! meine Burg!“ und hatte alles begriffen. Er wandte sich um; da sah er hinter dem Herzog Bewaffnete stehen. Der Degenberger fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, begab er sich wortlos zu seinen Leuten und hetzte heim. Auf dem Degenberg fand er aber nur mehr einen schwelenden Trümmerhaufen vor. Zwischen den erschlagenen Leibern seiner Getreuen lag auch der bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leichnam des geldgierigen Torhüters, welcher in verräterischer Weise, nur um des klingenden Lohnes willen, den herzoglichen Leuten das Burgtor geöffnet hatte, Frau Elisabeth hatte einige Stunden vor der Zerstörung mit einem Teil ihrer wertvollsten Habe die Burg verlassen dürfen.
Hans von Degenberg aber wurde trotzdem ein treuer und wertvoller Gefolgsmann, wie es schon seine Vorfahren waren und er erbaute sich im nahen Schwarzach ein großangelegtes Schloß für sich und seine Nachkommen.
Aus „Zwischen Hirschenstein und Donau“ von An.
Die fromme Magd vom Höhenberg
Vor vielen Jahren soll der Bauer auf dem Höhenberg bei Schwarzach eine Magd gehabt haben, die den hierzulande ungewöhnlichen Namen Mechthild trug. Aber das war nicht das einzige Besondere an ihr. Sie war so brav und fromm, daß sie noch kein Gebetläuten und keinen Engel des Herrn versäumt hatte. Um die Hände frei zum Beten zu haben, hängte sie während der Arbeit ihre Sichel einfach in die Luft, und wenn die gottesfürchtige Magd am Sonntag zur Messe ging, dann sprang die Bernrieder Kirchentür ganz von selbst auf.
Als einmal nach einem Unwetter ein Graben überschwemmt war, riß Mechthild eine Zaunlatte ab und legte sie über das Wasser, um trockenen Fußes hinüberzukommen. Sie vergaß aber, das Stück Holz wieder zurückzubringen. Von da ab blieb ihre Sichel nicht mehr in der Luft hängen, und die Bernrieder Kirchentür ging nicht mehr von selber auf – bis die Magd die Zaunlatte wieder an ihren Platz zurückgebracht hatte.
Von Josef Fendl
Das versunkene Schloß bei Degenberg
Bei Degenberg ist ein mit Waldbäumen bewachsener Hügel, auf welchem nach der Sage ein Schloß stand, das versunken ist. Von dem Schlosse bis Schwarzach soll ein unterirdischer Gang geführt haben. Auf dem Platze, wo das Schloß versunken ist, sah man zu Allerheiligen, auch Advent drei Fräulein, zwei weiße und eine schwarze. Ein Ritter wollte von dem Bauern Güter haben, die sie ihm nur unter der Bedingung überließen, daß er ihnen jährlich eine schwarze Henne gebe.
Nach Panzer
Die Sage vom Teufelsmühlstein
Ein Müller aus Bernried, nicht gerade der Frömmste seiner Zunft, kam einmal auf den absonderlichen Gedanken, sich mit Hilfe des Teufels eine Mühle in den Wald hinter dem Höhenberg zu baue. Als er fertig war, lud der Frevler die ungläubigen Bauern ein, ihm Korn zum Mahlen zu bringen. Niemand wollte glauben, daß die Mühle ohne Wasser funktionierte. Aber es war tatsächlich so. Die Müllerin, der das Treiben ihres Mannes nicht geheuer vorkam, schlich ihm eines Abends nach und wußte bald, wer hinter diesem abwegigen Getriebe steckte.
Am nächsten Tag schleppte sie einen Spritzkrug voll Weihwasser aus der Bernrieder Kirche auf den Berg hinauf und besprenge das Teufelswerk. Da stürzte es plötzlich mit lautem Gepolter zusammen. Aber die zahllosen Gesteinsbrocken begruben auch den Müller unter sich. Nur mit großer Mühe und unter ständigem Beten konnte sein toter Körper geborgen werden. Man begrub ihn auf dem Schwarzacher Friedhof.
Seit dieser Zeit nennt man die Steinansammlung nahe dem Weg vom Höhenberg zum Grandsberg den Teufelsmühlenstein.
Von Josef Fendl
Das Marterl bei Ay
Bei Ay in der Gemeinde Schwarzach steht ein altes Marterl, das die Vorübergehenden an eine merkwürdige Begebenheit erinnert.
In Dachsberg bei Haselbach lebte ein Bauer names Veit, ein Gotteslästerer schlimmster Sorte. Er arbeitete einmal in später Nachtstunde noch beim Mondschein auf seinem Feld und fluchte dabei gotteslästerlich. Da wurde er plötzlich von unsichtbarer Hand ergriffen und in die Lüfte geführt. Es traf sich, daß um diese Zeit der Mesner von Perasdorf aus dem Schlaf erwachte und wegen der Mondhelle glaubte, es sei schon Zeit zum Taganläuten, weshalb er eilends zur Kirche lief und das Glockenseil schwang. Im nämlichen Augenblick wurde der Bauer gerade über Ay getragen. Hier fiel er zur Erde. Hinter sich hörte er noch die Worte: „Jetzt muß ich ihn fallen lassen, weil der Laurentiushund bellt!“ Veit kam zwar scheinbar körperlich unbeschädigt nach Hause, starb jedoch bald nach dem Vorfall. An der Stelle, an der er zur Erde fiel, hat man ein Marterl errichtet.
Nach Emmi Böck
Die Alraunhöhle
Etwa eine Achtelstunde von Schwarzach entfernt, liegt die Alraunhöhle. Darin soll ein altes Weibchen gehaust haben, das man Alraun nannte. Wenn die Leute nachts an gewissen Orten in der Nähe der Schwarzach vorüberkamen, so wurden sie von der Alraun gereinigt, was auf so derbe Weise geschah, daß stets Blutsspuren am Kopf zurückblieben. Besonders häufig geschah das an zwei Schwarzachbrücken.
Nach Emmi Böck
Der seltsame Fisch im Rohrmühlbach
Vor vielen Jahren mußte im Rohrmühlbach ein seltsamer Fisch gelebt haben. Er war von ganz anderer Art als Fische hierzulande sind, und manche behaupteten, er sei aus dem Meer die Donau herauf- und dann in den Wald hineingeschwommen.
Immer, wenn ein Hochwasser bevorstand, im Frühjahr zur Zeit der Schneeschmelze oder bei unvorhersehbaren Wolkenbrüchen im Sommer, tauchte er unter der Brücke auf und hielt sich so lange dort, bis ihn der Rohrmüller zu Gesicht bekommen hatte und sich auf das bevorstehende Unwetter einzurichten begann. Fing dann das Hochwasser an, über die Ufer zu steigen, war der seltsame Fisch schon verschwunden.
Der Rohrmüller war froh, einen solchen Propheten unter seiner Brücke zu wissen denn so konnte er das Heu aus den Bachwiesen höher hinauftragen, das Holz vor seinem Haus ins Trockene schaffen oder sonst noch einiges beiseite räumen, was ihm das Hochwasser mitgerissen hätte.
Eines Tages nun hatte der Rohrmüller einen neuen Mühlknecht eingestellt, der zwar das Vaterunser nicht konnte, aber hinter allem her war, was sich rührte oder was ihm sonst in den Sinn kam. Uns als der Rohrmüller wieder einmal erzählte, der Seltsame stünde draußen unter der Brücke, verschwand der Kerl für einige Augenblicke aus der Mühlstube, und bis der Müller nach dem Knecht Ausschau hielt, bruzzelte der Fisch in der Eisenpfanne auf dem Herd. Seit dieser Zeit wußte der Rohrmüller nicht mehr, wann das Hochwasser kam, und manchmal hat es ihn mitten in der Nacht überrascht und großen Schaden angerichtet.
Verfasser unbekannt
Wie Welchenberg zu seinem Namen kam
Es war einmal ein Ritter, der sich im Vorwald nach einem geeigneten Ort für seine Burg umsah. Lange quälte ihn die Frage: „Wohin setze ich mein Heim? Auf welchen Berg? Auf welchen Berg?“ Und wie ein Echo klang es oft von den Lippen seiner Freunde und Trinkkumpane spottend nach: „Auf welchen Berg?“ Endlich war er sich eins: Gerade zwischen Metten und Bogen fand er einen prächtigen Platz auf einem versteckten Bergkegel und fing sogleich zu bauen an. Als die Burg fertig war, erinnerten ihn seine Freunde an sein Suchen und Umfragen und nannten die Burg boshaft Welchenberg.
Nach Emmi Böck
Unterirdischer Gang
Von der Burg auf dem Degenberg führte ein unterirdischer Gang herüber nach Schwarzenstein, wo eine kleinere Burg gestanden ist. Der Hügel in Schwarzenstein heißt heute noch Schloßberg. Auf dem Kerblhof (Leidl) kann man heute den Ausgang des Tunnels sehen, wenn die Mist- und Jauchegrube leer ist. Durch diesen Gang soll der Graf entkommen sein, als die Burg Degenberg vom Bayernherzog erobert wurde.
Nach A. Neuhofer
Kugelstattmoos
Auf dem Bergrücken des Schwarzacher Waldes ist das Kugelstattmoos mit einer Stadt, die leider ebenfalls versunken ist. Am Fronleichnamstage sieht man noch davon ein schwarzes Kreuz und hört bei Musik das Kegelscheiben. Am Schuhfleck gegen den Hirschenstein war der Marktplatz.
Nach Reinhard Haller
Zwischen Pröller und Hirschenstein
Der selige Englmar
Der Graf von Bogen schätzte einen frommen Einsiedler mit Namen Englmar hoch. Er war ihm so zugetan, daß er ihm weit fort in den Bergwald einen starken Knecht mitgab, der ihm Bäume umhauen und eine Klause bauen half. Und wenn beiden das Brot ausging, durfte der Siedelmann nach dem Schlosse des Grafen schicken.
Aber der Weg um das Brot war weit und den Knecht verdroß die Mühe. Auch ergrimmte es ihn, daß der Klausner so viel betete und fastete und einen harten Felsen als Bett wählte, denn: Ist der Herr streng gegen sich selbst, so schickt sich auch für den Diener kein Wohlleben.
Der Knecht kam so in Groll, daß ihm der Teufel einblies, seinen Herrn aus dem Wege zu räumen.
Englmar sah dem Diener in die arge Seele. Es war Winter. Der Gottesmann kniete nieder und betete lange. Dann stand er auf, trat zu dem Knecht und sprach: „Ich weiß, daß du mich erschlagen wirst; ich bin bereit. Christus ist mein Helfer.“
Als sich der Knecht so erkannt sah, erfaßte ihn Trotz und Zorn; er nahm die Axt und traf das Haupt des frommen Mannes, daß dieser tot hinsank. Die blutige Leiche verscharrte der Mörder in dem Schnee und bedeckte sie mit Reisig. Dann machte er sich auf die Flucht.
Fast ein halbes Jahr verging. Da kam ein Priester in die Wildnis des Bayerwaldes und schaute nach, warum Englmar seinen Knecht nicht  mehr um Brot schickte. Er fand die leere Klause. Als er aber des Nachts vor derselben im Moose ruhte, sah er ein liebliches, strahlendes Wunder. Engel mit Lichtern schwebten in langem Zug vom Himmel herab auf den Wald und sangen; sie erhoben sich singend wieder und gingen immerzu zwischen Himmel und Wald auf und nieder. Das war so schön, daß dem Priester vor Freude das Herz zitterte. Und er stand auf und schritt an die Stelle, wo der leuchtende Engelszug die Erde berührte; Reisig und Schnee vom Winter lagen an der Stelle.
mehr um Brot schickte. Er fand die leere Klause. Als er aber des Nachts vor derselben im Moose ruhte, sah er ein liebliches, strahlendes Wunder. Engel mit Lichtern schwebten in langem Zug vom Himmel herab auf den Wald und sangen; sie erhoben sich singend wieder und gingen immerzu zwischen Himmel und Wald auf und nieder. Das war so schön, daß dem Priester vor Freude das Herz zitterte. Und er stand auf und schritt an die Stelle, wo der leuchtende Engelszug die Erde berührte; Reisig und Schnee vom Winter lagen an der Stelle.
Der Priester räumte beides weg: siehe, da kam unverwest und wie lebend die Leiche des erschlagenen Englmar zum Vorschein. Voll Bestürzung und Ehrfurcht machte sich der Priester auf, die Kunde dem Grafen von Bogen zu bringen. Der erschien und erkannte den frommen Siedelmann. Und weit und breit vernahm man, was geschehen war, und Kranke wallfahrteten zu dem unverwesten Leibe und wurden gesund.
Mit einem langen Zug von Priestern begab sich der Graf von Bogen wieder an den Ort. Der Leichnam wurde auf einen Wagen gelegt, den zogen zwei Ochsen vom Berg herab durch Wald und Wildnis zu Tal. Im Tal blieben die Ochsen stehen und waren seltsamerweise nicht mehr weiter zu bringen. Das nahmen der Graf und die Priester für ein Zeichen und sie begruben den Erschlagenen an Ort und Stelle. Und über dem Grabe erbauten sie ein Kirchlein.
Das geschah in alter Zeit (um 1100). Aber noch heute wallfahrten Leute von nah und fern zum Grabe des seligen Englmar.
Nach Ludolf Silvanus
Englmar
Bei dem Dorfe Englmar im Bayerwalde erhebt sich der Predigtstuhl. Er hat seinen Namen von dem Eremiten Englmar, der hier den Tod  eines Märtyrers starb. Früher als Landmann im Passauischen begütert, hatte sich zu Ende des 11. Jahrhunderts der fromme Mann in die Einsamkeit der Waldwüste zurückgezogen. Graf Aswin, auf dessen Gebiet er seine Zelle erbaut, nahm ihn in seinen Schutz und befahl, daß ihm täglich aus der Küche des Schlosses Windberg Speise gebracht werde. Allein der Diener, welcher diesen Auftrag zu vollziehen hatte, ward seines Geschäftes bald überdrüssig und um sich den ermüdenden Gang auf rauhem Landpfade zu ersparen, tötete er Englmar meuchlings mit einem Wurfpfeile. Nicht lange nach dieser Greueltat kam der Graf auf der Jagd in die Gegend und sah zu seiner Verwunderung aus einem Gebüsche einen blendenden Glanz hervorstrahlen. Nachsuchend fand man dort den Leichnam Englmars.
eines Märtyrers starb. Früher als Landmann im Passauischen begütert, hatte sich zu Ende des 11. Jahrhunderts der fromme Mann in die Einsamkeit der Waldwüste zurückgezogen. Graf Aswin, auf dessen Gebiet er seine Zelle erbaut, nahm ihn in seinen Schutz und befahl, daß ihm täglich aus der Küche des Schlosses Windberg Speise gebracht werde. Allein der Diener, welcher diesen Auftrag zu vollziehen hatte, ward seines Geschäftes bald überdrüssig und um sich den ermüdenden Gang auf rauhem Landpfade zu ersparen, tötete er Englmar meuchlings mit einem Wurfpfeile. Nicht lange nach dieser Greueltat kam der Graf auf der Jagd in die Gegend und sah zu seiner Verwunderung aus einem Gebüsche einen blendenden Glanz hervorstrahlen. Nachsuchend fand man dort den Leichnam Englmars.
Nach Müller und Grueber
Der selige Englmar
Nach alten Reimen
Der selige Vater Engelmar
Im Bistum Passau Klausner war.
Dort in dem Wald er nimmer blieb,
Wo Raub und Mord sein Wesen trieb.
Er zog der Landschaft Bogen zu
Und bat den Grafen um gute Ruh.
In unsern einstens wilden Wald
Kam er durch Gunst des Grafen bald,
Der ihm das täglich Brot verhieß
Und sich als rechter Freund erwies.
Und Englmarus dankte frumm,
Versprach zu kommen wiederum.
Schnell sucht er auf den rauhen Bann,
Sinnt, wie er da sich fristen kann;
Baut sich ein Hüttlein schlicht u. klein,
Dient Jesus und Maria rein,
Bei einem Felsen Stund um Stund
Fiel er sich schier die Kniee wund.
Um Menschenheil er fleißg bat
Mit Beten, Fasten früh und spat.
In Not und Pein, von allem bloß,
Nur wenig Speise er genoß.
Es war ein harter Fels das Bett,
Wo Engelmarus ruhen tät.
Dies alles seinen Knecht verdroß,
Der tief im Busen Haß verschloß.
Dem ward auch leidig mehr u. mehr,
Vom Schloß zu tragen Speise her.
Da blies ihm denn der Teufel ein,
Er soll erschlagen den Vater sein.
Dem Heiligen war alles klar,
Noch eh‘ der Knecht gekommen war.
Und also sprach er zu dem Mann:
Dieweil ich mein Gebet getan,
Verübe, wes du willens bist;
Herr Jesus Christ mein Helfer ist!
Da schwang der Bösewicht sogleich
Die blanke Axt zum Todesstreich,
Traf in das Haupt den Klausner tief,
So daß ein Strom des Blutes lief.
Da war vollbracht des Frommen Lauf;
Die Seele nahmen die Engel auf.
Des Toten Leib vergrub der Knecht
Im Wald mit Schnee und Reisig schlecht.
Und als getan das Werk verrucht
Ergriff der Schelm wie Kain die Flucht.
Fünf Monate und manchen Tag
So Engelmar verborgen lag.
Doch siehe da, ein Priester kam,
Der seinen Weg durch Wildnis nahm.
Der sah am Himmel Wunder traun,
Verweilte still, sie anzuschaun,
Sah Engelein und Lichter schön
Da zwischen Wald und Himmel gehn.
Dann hörte er die Englein singen,
Das Herz tät ihm vor Freude springen.
Und eilends geht er an den Ort,
Zu räumen Schnee und Reisig fort:
Den unverwesten Leib er fand –
O höchster Schatz, o teures Pfand.
Der Priester sagt’s den Grafen an;
Der Graf erkennt den teuren Mann,
Tät kommen mit viel Priestern bald
In diesen wüsten rauhen Wald,
Damit bestattet sei der Leib,
Der Kranke heilte, Mann und Weib.
Er lag auf einem Wagen dann,
Zwei Ochsen zogen schicklich an.
Sie trabten ungezäumt zutal,
Und mit Verwunderung allzumal
Der Leib der Gruft ward anvertraut
ist! Und dieses Kirchlein drob erbaut.
Das alte Sühnekreuz
Hoch oben im Bergdorf St. Englmar, wo der Nebel am dichtesten in den tiefästigen Fichten hängt, steht abseits auf einer Hangwiese ein uraltes Steinkreuz. Ein niedriger Kirschbaum breitet seine Astknorren über das verwitterte Mal, das unter einem gewürfelten Schild mit der Jahreszahl 1467 eine schier unleserliche Inschrift trägt: „stefan fraß dem got genad.“
Von den ganz alten Leuten wußten manche noch eine wunderliche Geschichte über dieses Sühnekreuz zu erzählen und der frühere Pfarrer von St. Englmar, ein Herr Treiber, hat sie uns aufgeschrieben:
Der Ritter Stefan Fraß von Isareck, der aus der Chamer Gegend stammte, zog mit seinem Knecht durchs Gebirg. Als die beiden nach St. Englmar kamen, läutete es gerade zur Messe. Der Knecht bat seinen Herrn, in der Kirche des seligen Englmar beten zu dürfen. Der Ritter aber hatte nur Spot für ihn: „Was hast du für einen Glauben an diesem Fremdling, der doch nur ein Schindlklieber gewesen ist.“ Trotzdem besuchte der Knecht den Gottesdienst. Als er wieder zu seinem Herrn kam, fand er ihn an der Stelle, wo jetzt das Steinkreuz steht, mit gebrochenem Rückgrad. Mit schwacher Stimme erzählte der Sterbende: „Ein Has ist mir über den Weg gesprungen, daran hat sich mein Roß geschrickt und hat mich abgeworfen. Weil ich jetzt sterben muß, so laß hier ein Kreuz errichten, damit künftig niemand St. Englmar verachte, Gott duldet es nicht.“
So will es die fromme Sage wissen. In Wirklichkeit ist das alte Kreuz ein Mordstein aus dem Böcklerkrieg. Der Ritter Stefan Fraß war ein Lehensmann der Grafen von Degenberg gewesen, des Führers der aufständischen Böckler. So nannte man den Geheimbund der  einundvierzig aufrührerischen niederbayerischen Ritter, die sich 1466 zu Regensburg, der Reichsstadt, zur „Gesellschaft des Einhorns“ zusammengetan und dem bayerischen Herzog Albrecht IV. die Fehde angesagt hatten, sogar der Bruder des Herzogs Christoph hatte sich zu den Aufrührern geschlagen und die gegnerischen Heere taten einander und ihren Ländereien und dem Bauernvolk viel Schaden an.
einundvierzig aufrührerischen niederbayerischen Ritter, die sich 1466 zu Regensburg, der Reichsstadt, zur „Gesellschaft des Einhorns“ zusammengetan und dem bayerischen Herzog Albrecht IV. die Fehde angesagt hatten, sogar der Bruder des Herzogs Christoph hatte sich zu den Aufrührern geschlagen und die gegnerischen Heere taten einander und ihren Ländereien und dem Bauernvolk viel Schaden an.
Im Verlauf der jahrelangen Fehden wird unser Stefan Fraß wohl einmal den Knechten des Bayernherzogs, die bei Markbuchen den Grenzübergang bewachten, in die Hände gefallen sein und hat unter ihren Schwertern und Spießen schmählich geendet.
Von der Stammburg der Degenberger, die sich hinter Schwarzach auf einem vorspringenden Bergzug erhob ‚blieben nur die Grundmauern stehen und erzählen noch heute in ihrer weitläufigen Anlage von der einstigen Pracht des Rittertums und ihrem letzten Aufbegehren gegen eine neue, von der Macht des Geldes getragenen Herrschaftsform.- Wie wenig ist davon geblieben! Ein Märlein, das nicht mehr um den Ursprung weiß, ein Schutthügel, wo Birken und Tollkirschen über verfallenen Gewölben wuchern.
Nach A. Neuhofer
Der selige Englmar als Helfer
Einige urkundliche Aufzeichnungen geben Kunde von vielen Heilungen durch den Waldvater Englmar:
Zu Kriegszeiten kamen Plünderer hierher, raubten das Vieh und wollten es forttreiben. Als sie mit den Tieren auf die Äcker bei Meinstorf kamen, sei der Anführer tot niedergefallen, die anderen seien erblindet. Weil diese aber ihre Sünden bereut hatten und Besserung gelobten und versprachen, die Tiere zurückzugeben, seien sie wieder sehend geworden. Seither führen die Äcker den Namen Sehäcker.
Ein Peter Huber, Schneider von Sünzing, sei an der ungarischen Krankheit darniedergelegen, ohne daß ihm jemand helfen konnte. In seiner Hilfslosigkeit erschien ihm der heilige Tröster Englmar, von dem er vorher niemals etwas gehört hatte. Dieser forderte ihn zu einer Wallfahrt nach Englmar auf. In Straubing fragte er umher, wo der Ort Englmar sei; endlich konnte ihm der Wächter an der Donaubrücke Auskunft erteilen. Schon auf dem Wege sei es allmählich mit ihm besser geworden. Nachdem er in der Kirche zu Englmar ein Opfer dargebracht hatte, habe er seine völlige Gesundheit wieder erlangt.
Thomas Meindl, ein Bauer aus der Pfarrei Rimbach, Lichtenecker, 50 Jahre alt, war 16 Wochen schwer krank, so daß er keinen Tritt mehr gehen noch stehen konnte und keinen Biß essen. Er verlobte sich mit einer jährlichen Kirchenfahrt und einer heiligen Messe nach Englmar, solange er lebe. Ist alsbald mit freudiger Gesundheit wieder seinen Weg gewandelt. So geschehen im Jahre 1621.
Veith Puckhl, bei 50 Jahre alt, bezeugte: Wenn einer im Viechtacher Landgericht ungezähmte Ochsen das erste Mal im Namen des seligen Englmar anspanne, sollen sie nach gemeiner Aussage wohl geraten.
Der Vogelsang
Der Vogelsang ist ein Nachbarberg des Hirschensteins. Der ganze Berg Vogelsang, der seinen Namen von zahlreichen Heidelerchen hat, die mit munterem Getriller sein Plateau beleben, gehörte einst zu der ehem. Cistercienserabtei, deren Kirche und Gebäude im Dorfe Gotteszell am Fuß des Berges noch immer erhalten sind. Das Kloster wurde von Ritter Heinrich von Pfelling und seiner Gemahlin Mechthilde aus den Steinen der abgetragenen Burg Ruhmannsfelden errichtet. Lange, obgleich von vielem Unheil getroffen, blühte die Abtei, bis der Geist der neuen Zeit wie so viele andere auch sie der Verschollenheit anheimgab. Aber die Sage läßt Gotteszell wiedererstehen. Auf dem Vogelsang wird dereinst ein Fürst unter einer vereinsamten Tanne rasten, und die Klostertaube wird den Brautring der Stifterin Mechthildis im Schnabel bringen und auf dem verdorrten Baume sitzend, unbekannter Worte geheimen Sinn enträtseln.
Alsdann wird das Kloster Gotteszell erneuert werden und als Stätte der Frömmigkeit und Gelehrsamkeit hervorragend sein wie in alter Zeit.
Nach Ludolf Silvanus
Der wilde Jäger am Hirschenstein
Im Ödwieser Wald am Hirschenstein lebte vor vielen hundert Jahren ein Köhler, der eine überaus schöne Tochter hatte. Die ging oft in die hohen Forste hinauf, Erdbeeren zu brocken, die ihr Vater so gerne aß. Eines Tages aber gelangte sie an einen Bach und sah dort unter einer uralten Buche einen großen, bleichen Mann; der hatte ein kohlschwarzes Pferd, viele Hunde und Jagdfalken bei sich. Schau, da erschrak freilich die Wäldlerin; als aber der Jäger freundlich tat, ward sie zutraulich und bot ihr Körblein voller Beeren dar. Der Fremde labte sich; dann aber bestieg er sein Roß und sprengte mit dem Maidlein vor sich der Köhlerhütte zu.
Wie der Alte staunte über solch vornehmen Besuch! Und was er sich drauf einbildete, als der Herr, nachdem er übernachtet hatte, das Mädel gar zur Frau begehrte!
Und es ward Hochzeit am Abend vor dem neuen Jahre. Da gab’s freilich ein Gepränge, wie’s die arme Hütte nie gesehen hatte, eine Unzahl vornehmer Gäste, dazu eitel Lustbarkeit und Schabernack in all dem grünen Wald ringsum. Nur eines war, dessen die blendend geschmückte Braut nicht zufrieden war, daß nämlich der Bräutigam Auskunft über Name und Wohnsitz verweigerte.
„Seine Liebe ist etwa nicht recht!“ raunte das Töchterlein dem Vater zu und drang immer ungestümer in den unheimlichen Hochzeiter bis gegen Mitternacht. Da brach plötzlich ein höllisches Ungewitter los, Blitze schlugen in die Köhlerhütte, so daß sie lichterloh aufflammte. Aus der Glut aber fuhr auf seinem Rappen der fremde Jäger mit der schneeweißen Braut vor sich auf dem Sattel; eine Schar wilder Reiter, heulende Hunde und kreischendes Waldgevögel folgten hinterdrein.
Früherszeiten ward in stürmischen Nächten dieser Zug noch oft über den Wäldern des Hirschensteins und weiterhin gehört und gesehen, der Schrecken einsamer Wanderer, das wilde Heer oder Nachtgejaide! Jetzt ist dieses freilich zur Ruhe gekommen; aber beerensammelnde Kinder wollen am Hirschenstein noch immer ein weißes Mägdlein sehen, das mit einem Körblein voll roter Beeren an einer Quelle sitzt und herzbeweglich singt und klagt.
Nach Ludolf Silvanus
Sagen um den Hirschenstein
1.Vor undenklichen Zeiten, als das Wild noch gehetzt wurde, verfolgte die Meute einer ritterlichen Jagdgesellschaft einen Edelhirsch bis auf den Gipfel des Berges. Dort ragt ein ungeheurer Felsblock, der von einer Seite wohlzugänglich ist, aber auf der andern plötzlich, schier lotrecht abfällt. Als der prächtige Sechzehnender seinen Verfolgern nicht anders zu entkommen vermochte und die keuchenden Hunde sich schon in seine Schenkel verbissen, während von allen Seiten Geschrei der Jäger und Horngeschmetter erscholl, da sprang der Hirsch in seiner Angst blindlings über die Felswand hinab. Zerschmettert lagen Wild und Meute in der dunklen Tiefe. Seit diese peinvollen Hatz, heißt es, hat der Hirschenstein seinen Namen.
- Zwischen dem Schwarzacher und dem Bärnriedertal befindet sich die Teufelsmühle, wo früherszeiten der Teufel unter großem Spektakel mit zwei Steinen Mehl bereitet haben soll. Aber auf dem nahen Rauhen Kolm lebte dazumal ein frommer Klausner; der stellte dem Störenfried das Handwerk ein, indem er drei Kreuze in die Felsen meißelte. Daraufhin fiel der größere Stein um. Wenn die Sonne aufgeht, kann man in seinem Schatten noch immer des Teufels Kopf erkennen.
Nach Ludolf Silvanus
Der Teufel von Ödwies
Im Winter 1948 auf 49 machte ein Föhn die Menschen im Bayerwald zur Zeit der Rauhnächte besonders empfindlich für geisterhafte Vorkommnisse. Der Förster v n Ödwies, gewiß ein Geisterseher, ein furchtloser Mann, schüttelte den Kopf. Unglaublich, was sie ihm da in allen Einzelheiten erzählten! Ja, in Ruhmannsfelden, in Achslach, in Gotteszell, in den Höfen, in den Hütten und in den Wirtsstuben erzählte mans sich.
Ein städtisches Schulfräulein, welches an diesem Tage mit dem Zug gekommen war, hatte bald diese gruselige Geschichte aufgelesen. Es war eine begeisterte Skiläuferin, die ein paar Tage der Ferien im gastlichen Ödwieser Forsthaus verbringen wollte. – Müde kam sie bei der Dämmerung im Fortshaus an. Bald ging sie nach der Försterfrau guter Bewirtung in ihre Kammer, die im kleinen, hölzernen Häuschen neben dem Forsthaust lag. Zur ebenen Erde, war ihr beschieden worden, sollten zwei Waldknechte schlafen; ein alter und ein junger. So um die Mitternacht begegnete ihr plötzlich auf dem Gang über die Stiege ein kleines Männchen im kurzen, grünen Hemd, blassen, dünnen, mit Stacheln bestandenen Füßen, das eine Laterne vor sich hertrug. Sein Gesicht bedeckte ein wirres Haarmoos. Den Mund umwucherte struppiger Schnauzbart. Ein paar Augen funkelten wild. Das Männchen blieb für einen Augenblick stehen, setzte sich dann aber wieder in Bewegung und verschwand endlich in einem Winkel hinter einer schmalen Tür. – Das Schulfräulein kehrte erschrocken um.
Nach einer unruhigen Nacht begrüßte die Skiläuferin den Morgen mit einem tiefen Aufatman. Sie schnallte ihre Skier an und zog über die Ödwiesen fort in den Wald. Der „Ödwieser Teufel“ trieb sie bald zurück zum „Häuslmo“, dem Forstarbeiter, der mit seiner Familie in der Ecke der Ödung in einer Waldlerhütte hauste. – Dort saß sie unter, auf der „Hennerbänk“, sagte nichts von ihrer nächtlichen Erscheinung, aber dafür brachte sie die Erzählung auf die bereits umgehende Geschichte. – Freilich kannte er sie, der „Häuslmo!“ Und haargenau berichtete er sie:
„Do habns am Platzl drunt as ausgsetzte Holz aufgladn, de Baamer. Weils net gnua kriagt habn, habns zvui am Wagn aafe. D Rösser habns net derzogn, as Holz. – Net ums Verrecka sag i dir. A Strang ist grissn. Zeit is wordn. Do habns as Flucha aghebt. A so habns gfluacht, daß se sogar d Rösser selm gfürcht habn. Und wias in der letztn gschrian habn: „Wenn nur glei der Deifi kam!… Do, sag i dir…!“
Der Häuslmo und sei Weib, die sich gegenseitig schauerverstehend angeschaut hatten, machten eine Gedenkpause, und eine längere Wortpause dazu. –
Dann erzählte er das Geschehen weiter: „Do sag i dir, kommt a kloans, graabs Mandl daher und ziagt hinter eahm her a groaß Roß. – Bleibt steh, schaut, packt de Rösser ohne a Wort. De Rösser ziagn o, ziagn weg. – Leicht sogar. Na gibt ers de Baamer in die Händ. – Und di fahrn se mit oanmol leicht dahi.“ Nach einer abermaligen Pause: „Und na is’s kloa, graab Mandl unters eigne Roß einegstandn, so kloa wars. Na hats gasgt:“Es werds net weit kemma, na seids wieder im Grabn drinn.“- Furt wars. Bald sands a scho in Grabn drinna gwen. Da hams gschaut. Koaner hat mehr gfluacht. Zittert habns. Ausgespannt habns. D Rösser habns gnumma und san furt in der Nacht und s Pech hat eahna nachestunka. Gwiß war! Ohne Wagn und ohne Blöcher sands unten akumma und habn nach einer Weil derzählt, wia eahna der Deifi von Ödwies erschiena is.“
Am Abend dieses Tages saßen der Förster und seine Familie im Gastzimmer. Alle lauschten den Worten des aus Ruhmannsfelden Heimgekehrten: „Und des Kloa, graab Mandl moane, des kenn i,“ sagte geheimnisvoll der Förster. „den sein Deifi, moanat 1, hätt ma im eigna Haus.“ – Dann stand er auf und ging mit langsamen, schweren Schritten zur Küche, in der an einem eichenen Tische an der Wand das Gesinde des Fortshauses beimEssen saß: die Hausmagd, der junge Knecht und… der „Teufel höchstpersönlich…. Es war der alte Knecht namens Frisch Michel. Klein und schnauzbartet saß er in Hemdsärmeln über einem Laib Brot, den er eben mit einem feststehenden Messer bedrohte. Armsündergeduckt schaute er unten herauf. Gut die Hälfte seiner knechtischen Falten formten zur Minute um ein paar gekniffene Augen die tiefste Verschmitztheit.
Während der Förster an den Familientisch zurückging, sprach er schmunzelnd vor sich hin: „Muaß der kloane Michl, den i mit dem haochghaxaten Roß nach Ruhmannsfelden zum Schmied gschickt hab, aber ausgerechnet do daher kumma, wia se de Baamer den Deifi selber gwünscht habn!“
Nach Hermann Neumeyer, gek.
Sage über die Entstehung des Dörfchens Rettenbach
In der Waldabteilung Kugelstadt des Forstverwalterbezirkes Schwarzach bei Bogen liegt ein größeres Hochmoor. Nach der Sage stand einst an der Stelle, wo sich dieses ausbreitet, eine mächtige, reiche Stadt mit vielen Einwohnern. Letztere waren aber sehr böse, führten ein sündhaftes Leben, lästerten Gott und verspotteten die Heiligen. Gottes Güte und Barmherzigkeit schickte ihnen einen frommen Mann, der sie liebevoll zur Sinnesänderung mahnte und den Weg zum Guten lehrte. Seine gütigen Worte fanden jedoch nur taube Ohren und verstockte Herzen. Wenige, meist arme Bewohner hörten dem Bußprediger andächtig zu, nahmen seine Lehre zu Herzen, besserten sich und führten ein gottwohlgefälliges Leben. Da der fromme Lehrer von der Erfolglosigkeit seines Wirkens 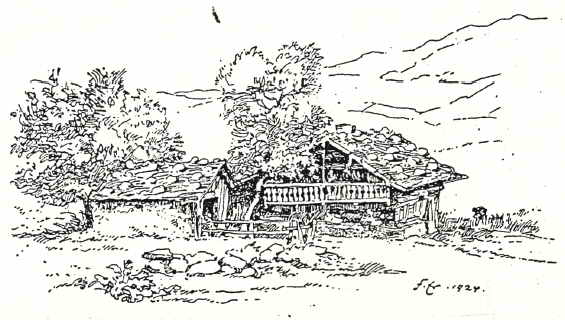 überzeugt war, verließ er den sündhaften Ort. Vor seinem Abschied versammelte er zum letztenmale seine Getreuen um sich und gab ihnen den Rat: „Rettet euch über den Bach, wenn Gott das Strafgericht schickt, das er über die Stadt verhängt hat.“
überzeugt war, verließ er den sündhaften Ort. Vor seinem Abschied versammelte er zum letztenmale seine Getreuen um sich und gab ihnen den Rat: „Rettet euch über den Bach, wenn Gott das Strafgericht schickt, das er über die Stadt verhängt hat.“
Eines Tages verlor die Sonne ihren Schein. Ein mächtiger Sturm brauste; schwarze Gewitterwolken wälzten sich heran; feurige Blitze zuckten; gewaltige Donnerschläge dröhnten; ungeheure Wassermassen stürzten hernieder und ein Beben erfolgte, daß die Grundfesten der Erde erzitterten. Plötzlich versank die Stadt mit ihren Einwohnern. Nur wenige retteten sich durch schleunige Flucht über den Bach. Am rechten Bachufer ließen sie sich die vom Untergange verschonten nieder, bauten Wohnhäuser und nannten die neue Ansiedlung Rettenbach.
Verfasser unbekannt
An der „Weißen Marter“
Einen Büchsenschuß nur oberhalb der Straße, die von Mühlbogen steil und steinig über das einstige Bräuhaus und die Vorspannstation Meinstorf nach St. Englmar herausführt, eine kleine Gehstunde davon noch entfernt, lag die alte Waldkapelle zur Weißen Harter. Mitten im hohen Holze liegt es an einem einsamen Kreuzweg.
Brandgeruch liegt in der Luft. Von den Englmarer Höhen herüber fällt ab und an ein Musketenschuß. Am Vormittag noch hatte die Kirchenglocke angstvoll gewimmert, nun liegt sie unter dem Mauerschutt des eingestürzten Turmes und dem rauchenden Gebälk des Kirchendaches begraben. Am frühen Morgen dieses Unheiltages hatte ein dichtes Schneetreiben eingesetzt, das nach wenigen Stunden eine ganze Hölle voller Teufel ausspie. Die Schweden zogen in diesen Tagen brandschatzend das Regental hinauf und hatten einen Haufen Soldaten zum Fouragieren über die Marktbuchener Paßhöhe geschickt. Zu spät für das arme Bergbauerndorf, Vieh und Korn, Weib und Kinder in unzugänglicher Waldwildnis zu bergen!
Aber mehr noch als dem Dorf hatte der Zug der schwedischen Rotte der Kirche des seligen Englmar, der damals weltberühmten Wallfahrt, gegolten. Doch nicht zu frommer Einkehr. Johlend waren  die groben Eisenfresser in das kleine Gotteshaus eingedrungen und ihre Flüche hallten von den spitzbogigen Gewölberippen wider, als statt Gold und Geschmeide nur eisengeschmiedete Öchslein und Rösser und Immen und die Wachsbilder menschlicher Gliedmaßen, die frommen Votivtafeln bäuerlicher Bittsteller in ihre gierigen Hände fielen. Die bunten Kirchenfenster zerklirrten, Hellebardenhaken rissen die bleiernen Rahmen herunter, daß sie zu Musketenkugeln vergossen würden. Wild bellte die Meute nach dem güldenen Kirchenschatz. Den Pfarrer wollten sie schinden, bis er Kelch und Monstranz verriete und schon schrien sie nach Trichter und Odelschapf, ihm den Schwedentrunk einzunöten.
die groben Eisenfresser in das kleine Gotteshaus eingedrungen und ihre Flüche hallten von den spitzbogigen Gewölberippen wider, als statt Gold und Geschmeide nur eisengeschmiedete Öchslein und Rösser und Immen und die Wachsbilder menschlicher Gliedmaßen, die frommen Votivtafeln bäuerlicher Bittsteller in ihre gierigen Hände fielen. Die bunten Kirchenfenster zerklirrten, Hellebardenhaken rissen die bleiernen Rahmen herunter, daß sie zu Musketenkugeln vergossen würden. Wild bellte die Meute nach dem güldenen Kirchenschatz. Den Pfarrer wollten sie schinden, bis er Kelch und Monstranz verriete und schon schrien sie nach Trichter und Odelschapf, ihm den Schwedentrunk einzunöten.
Doch der Pfarrhof war leer, als sie mit ihrem Marterwerkzeug hineinstürmten. Die Bauern hatten, so verängstigt sie auch selber waren, ihrem geistlichen Herrn rechtzeitig Warnung getan. Als die erste Flammenzungen aus dem Pfarrhaus schlugen und der rote Hahn die Wut der Plünderer aufs hölzerne Schindeldach der Kirche hinübertrug, hetzte Herr Urban Mittermeyer, Pfarrer zu Englmar, auf der Meinstorfer Straße talaus. Die weiße Kutte der Prämonstratenser schug ihm um die zitternden Knie und verschwamm im Dämmergrau des treibenden Flockenschwalls zu einem gespenstischen Wisch, aus dem die Augen des Fliehenden ‚schreckhaft geweitet, glühten. Wollte er sich von den Soldatengreueln in den verfilzten Hängen des Mühlberges verstecken? Trachtete er, im heimischen Kloster Windberg, draußen vor den großen Wäldern Schutz und Rettung zu finden?
Schon glaubt er sich außer Gefahr, denn der Weg senkt sich bereits ins Tal. Da klopft dumpfer Hufschlag durchs dichter werdende Schneegestöber. Die Schweden sind hinter ihm her! Sie wollen sich den Spaß nicht entgehen lassen, den Kuttenmann durch die Spieße zu jagen. Ein verängstigtes Dorfbübel, dem sie das Faustrohr vor die tropfende Nase hielten, mag verraten haben, welchen Weg der Flüchtige nahm. Und dann führt der unschuldige Schnee die Menschenjäger an ihr edles Wild.
Im einsamsten Wald, an uraltgeheiligter Stelle, vollendet sich das Geschick des Priestermönches. Wieder einmal scheint die viehische Grausamkeit den letzten Trumpf behalten zu haben.
Als der Windberger Abt Michael Fuchs acht Jahre nach dem Friedensschluß zu Münster Kirche und Pfarrhof von Englmar neu und prächtig erbaute, errichteten fromme Bauersleute an der Mordstelle das kleine Heiligtum. Zwar kündet kein Stein und kein Wissen im Volk vom harten Sterben des Paters Urban, doch im Kloster Windberg, wo seine Gebeine neben dem Altar im Kapitelsaal in einem hölzernen Schreine ruhen, wird ihm noch heute ein ehrenvolles Gedenken bewahrt. – Die alte Waldkapelle steht nicht mehr, sie wurde durch einen Neubau ersetzt.
Nach A. Neuhofer
Im Reitermoos
Am Ostabhang des Pröllergebietes, wo der Riedbach seine Quellen sammelt, dehnt sich zwischen schütterem Baumwuchs das Reitermoos. Wie eine saftgrüne Wiese mutet es den Unkundigen an und nur die schwarzen Wassertümpel, die da und dort zwischen den Binsenhorsten blinken, verraten die unheimliche Tiefe. Im Sommer flirren Libellen über die trügerische Fläche und zur Zeit der langen Nächte geistert ein schauriges Märlein durch die Waldbauernstuben.
War es im Schwedenjahr? Oder schon 200 Jahre zuvor, als die tschechischen Hussiten das Waldland brandschatzten? Für die geschundenen Bauernmenschen war es einerlei, welchen Namen der raubende Soldatenhaufen trug, der von Kollnburg den steilen Bayerweg heraufritt. Vielleicht sind es auch Degenberger Kriegsleute des Böckleraufstandes gewesen oder die grausamen Panduren des Obersten Trenck. Einen Hütbuben hatte sich ihr Anführer an den Steigbügel gebunden, der den Weg über die Paßhöhe weisen sollte. Aber der Bub, der wohl aus Englmar gebürtig sein mochte und für sein Heimatdorf und die Seinen das Ärgste befürchtete, wagte sein Leben. Auf der „Eben“ droben sei eine stark bemannte Schanze errichtet und kein friedsames Durchkommen dort, so beredete er die fremden Kriegsleute. Doch wisse er einen heimlichen Seitenpfad durch den Wald, der von der anderen Seite ungefährdet ins Dorf führe.
Es war ein Weg ins Verderben. Dem Schreien und Fluchen der Berittenen, die der verwegene Bursch ins ausweglose Moos gelockt, schloß bald der schwarz Faulschlamm das unflätige Maul. Ob der beherzte Retter des Dorfes heil den Betrogenen entkam? Die Sage will es uns glauben machen, wie sie auch vom scheurigen Rufen und Stöhnen, von Rosseschnauben und Waffengeklirr wissen will, das in stürmischen Herbstnächten über dem Reitermoos zu hören sein soll.
Nach W. Bunz/A. Neuhofer
Rund um Mitterfels
Der Pfleger von Mitterfels
Der Pfleger von Mitterfels war, was man zu seiner Zeit einen exakten Beamten nannte. Er hielt die Bauern so in Respekt, daß sie schon vor dem Schatten seiner Hutfeder zitterten. Er wußte aus einem leeren Büchsenranzen noch Fett zu pressen. In seinem weitläufigen Gerichtsbezirke gab es keinen einzigen schlechten Zahler, denn der Ärmste trachtete schon vor dem Termin, die Abgaben zu entrichten und verkaufte lieber seine letzte Kuh, eh er sich die Schergen des Pflegers ins Haus kommen ließ. Wen sein Richtereifer sich einmal zum Gegenstande ausersehen hatte, der kam schwer wieder los; denn in der Kunst, die Inquisiten beim Verhöre in Widerspüche zu verwickeln und die Starrsinnigen durch die scharfe Frage zum Geständnis zu bringen, tat es dem Pfleger von Mitterfels keiner im Lande zuvor. „Ich habe einen Beichtstuhl, in welchem nicht die kleinste Sünde verschwiegen bleibt,“ äußerte er manchmal scherzweise im Kreise seiner Bekannten. Dieser Beichtstuhl war die Folterkammer mit den gefürchteten Folterwerkzeugen.
Damals lebte in Elisabethszell eine junge Dirne, welche sich Anna Osterkorn schrieb. Diese lieh dem Gekose der jungen Burschen ein allzu williges Ohr. In der letzten Zeit galt Georg, der Jäger des Gutsherrn in Haibach, als der Hahn im Korbe. Nani dachte nun endlich im Ernst daran, unter die Haube zu kommen. Die Hochzeit schob sich jedoch länger hinaus, als dem Pärchen lieb war. Dem Jäger wollte es nicht gelingen, eine einträglichere Stelle zu bekommen; Nani hatte nichts als eine halb verfallene Hütte, welche sie von ihren früh verstorbenen Eltern, armen Taglöhnersleuten, geerbt hatte. Ein Jahr nach Beginn ihrer Bekanntschaft mit Georg fand der Totengräber in einem abgelegenen Winkel des Friedhofes einen frisch aufgewühlten Rasen. Er untersuchte das Fleckchen näher und stieß auf die Leiche eines neugeborenen Knäbleins.
Der Totengräber machte von seinem Funde im Pfarrhofe Anzeige. Die Neuigkeit verbreitete sich schnell im ganzen Dorfe. Im Kreise frommer „Betschwestern“ flüsterte man den Namen Nanis, und zum Überfluß trat auch noch die Nachbarin auf und beteuerte, sie habe während der vergangenen Nacht in Nanis Stube deutlich ein Kind schreien hören. Obwohl jedermann wußte, daß die alte Matrone auf zehn Schritte weit das Kreischen einer Gans nicht von dem Schlage eines Finkenmännchens unterscheiden könne, fand ihre Aussage doch vollen Glauben. Die arme Nani wurde des Mordes schuldig gehalten. Der Klosterrichter wurde verständigt; dieser fand Nani im Bett todesschwach an und kaum imstande, auf seine Fragen Antwort zu geben. Er nahm ein Protokoll auf und schickte es durch einen reitenden Boten nach Mitterfels.
Als Nani wieder zu Kräften gekommen war, wurde sie in Ketten gelegt und nach dem Amtshause von Mitterfels abgeführt.
Schon bei der ersten Vernehmung bekannte sie, daß sie die Mutter des gefundenen Kindes sei, wies aber den Verdacht, es ermordet zu haben, entschieden zurück. Das Kind sei tot zur Welt gekommen und alle Heiligen im Himmel müßten ihr bezeugen, daß sie die lautere Wahrheit spreche. Das Gericht stellte ihr die Angaben jener alten Frau gegenüber, welche das Kindergeschrei gehört haben wollte. Breits im zweiten Verhör ließ der Richter sie bis aufs Blut mit Ruten peinigen. Halbtot schleppte man die Mißhandelte ins Gefängnis zurück.
Nanis Wunden waren noch nicht vernarbt, da wurde sie neuerdings  ins Verhör genommen. Diesmal führte man sie in eine dumpfe, modrige Stube, welche in einem der Ringtürme des Felsenschlosses lag. Ein Spitzbogenfenster erhellte das schummrige Gemach. Die dem Fenster gegenüberliegende Wand war durch ein rotes Tuch verdeckt. Der Pfleger saß in einem blutrot beschlagenen Lehnstuhl. Nani überlief ein eiskalter Schauer. Nani sollte bekennen, daß das Kind lebend zur Welt gekommen sei, Da sie immer wieder das Gegenteil beteuerte, öffnete sich der rote Vorhang, und es wurde in einem mit Folterwerkzeugen aller Art ausgestatteten Nebengemach der Henker sichtbar. Nani starrte ihn schweigend an. Dieser faßte sein Opfer unter den Armen, während sein Gehilfe einen mit Nägeln beschlagenen Stuhl, den sogenannten Igel zurechtrichtete. Nani wollte nun lieber dem Leben entsagen, als sich zum Krüppe1 foltern zu lassen. Sie trat vor den Pfleger und schrie ihn an: „Bluthund, weil du durchaus meinen Kopf willst, ja, ich habe das Kind ermordet!“ Hierauf wurde Nani zum Tode verurteilt und starb unter dem Schwert des Henkers.
ins Verhör genommen. Diesmal führte man sie in eine dumpfe, modrige Stube, welche in einem der Ringtürme des Felsenschlosses lag. Ein Spitzbogenfenster erhellte das schummrige Gemach. Die dem Fenster gegenüberliegende Wand war durch ein rotes Tuch verdeckt. Der Pfleger saß in einem blutrot beschlagenen Lehnstuhl. Nani überlief ein eiskalter Schauer. Nani sollte bekennen, daß das Kind lebend zur Welt gekommen sei, Da sie immer wieder das Gegenteil beteuerte, öffnete sich der rote Vorhang, und es wurde in einem mit Folterwerkzeugen aller Art ausgestatteten Nebengemach der Henker sichtbar. Nani starrte ihn schweigend an. Dieser faßte sein Opfer unter den Armen, während sein Gehilfe einen mit Nägeln beschlagenen Stuhl, den sogenannten Igel zurechtrichtete. Nani wollte nun lieber dem Leben entsagen, als sich zum Krüppe1 foltern zu lassen. Sie trat vor den Pfleger und schrie ihn an: „Bluthund, weil du durchaus meinen Kopf willst, ja, ich habe das Kind ermordet!“ Hierauf wurde Nani zum Tode verurteilt und starb unter dem Schwert des Henkers.
Georg, der Bräutigam, hatte seine Herrschaft auf einer Lustreise nach Wien begleitet und lebte dort in Freuden. Als er die Kunde von Nanis Hinrichtung erhielt, riß er seine Büchse von der Wand und verschwand. Einige wollten wissen; daß er unter die ungarischen Grenzräuber gegangen sei.
Nicht lange nach Nanis blutigem Ende kehrten zu Elisabethszell einigen Dirnen spät am Abend von der Rockenstube heim. Als sie an der verlassenen Wohnung der Hingerichteten vorübergingen, vernahmen sie darin Laute wie das Weinen eines neugeborenen Kindes. Sie liefen davon und erschreckten mit der Nachricht von dem Spuke das ganze Dorf. Niemand wagte, das Haus zu betreten. Da nahm ein alter Soldat den Mut. In der einen Hand hielt er einen Knüttel, in der anderen eine brennende Kienfackel. Was er fand, war ein alter Hauskater. Siegesstolz zeigte er diesen den neugierigen Leuten, die nun in ein lautes Gelächter ausbrachen. Doch viele lachten nicht mit, ihr Gewissen war nicht ganz rein, als sie an schreckliche Folgen der letzten Tage dachten. Eine Unzahl Vaterunser wurden für die Tote gebetet, die Glocken der Kirche läuteten zu den Seelenämtern.
Ungefähr nach einem Jahr Ritt der strenge Pfleger von Straubing heim. In der Nähe des Hochgerichtes gab er dem Pferde die Sporen, um schneller an der Richtstätte vorbeizukommen. Plötzlich rollte ein Totenschädel die steile Böschung herab und fiel mitten auf den Weg. Das erschreckte Pferd scheute, machte einen Seitensprung und stürzte et seinem Herrn in den zur Seite hinlaufenden Abgrund. Sein Begleiter machte gleich Meldung im nahen Schlosse. Die Schreckensbotschaft brachte das ganze Haus auf die Beine. Den Pfleger fand man mit gebrochenen Beinen in der Schlucht. Man brachte ihn mit Mühe den Berg herauf und in das Schloß. Da lag er die ganze Nacht in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Am Morgen gegen 9 Uhr, zu derselben Stunde, in welcher Nanis schuldloses Haupt gefallen war, schlug er die Augen auf und stammelte in höchster Angst: „Bringt mir die Akten in Sachen Osterkorn. Ich habe mich vor einem strengen Richter zu verantworten; schon ruft mich sein Bote. Gnade! Gnade!“- Es waren seine letzten Worte. Er sank in die Kissen zurück und war eine Leiche.
Nach Adalbert Müller, gek.
Zur Geschichte. Liste der Pfleger und Richter aus adeligen Geschlechtern, die auf den Schlössern Au, Steinburg, Haggn und Pürgl seßhaft waren.
Pfleger: 1322 Wilhelm Heuraus, 1394 Hans der Rainer, 1439 Tristan Zenger, 1510 Georg Heuraus, 1512 Christoph Paulsdorfer, 1545 Balthasar Türriegel, 1655 Viktor Adam Frh. v. Seyboltstorff, 1752 Maximilian Frh. v. Asch;
Richter: 1439 Tristan Zenger, 1485 Wilhelm Heuraus;
Pflegsverwalter: 1527 Balthasar Türriegel, 1529 Georg Heuraus, 1582 Wolf Kastner;
Pflegskommissär: 1656 Ott Heinrich v. Seyboltstorff
Die Sage von der Lederbrücke
Neben der alten Burg Mitterfels, dem heutigen Amtsgericht, auf der gegenüberliegenden Höhe jenseits des Perlbaches, soll einst eine zweite Burg, wahrscheinlich die Wirtschaftsburg (Burgstall) gestanden haben.
Von der Burg Mitterfels zur Ausnahmsburg Neumitterfels führte eine Art Seilbahn: Die Lederbrücke. Zu Belagerungszeiten konnten so Lebensmittel von der kleineren Burg herüber zur Hauptburg befördert werden.
Eines Grafen Sohn erhob einst Anspruch auf das Stammschloß. Der alte Graf hingegen wollte noch nicht übergeben und verwies den Sohn ins Ausnahmshaus. Wütend verbarg sich dieser in einem Faß und ließ es über die Lederbrücke ziehen. Plötzlich riß der Riemen und unten fand man zerschmettert den jungen Grafen. Der Dolch, mit dem er den Vater ermorden wollte, stak mitten in seinem Herzen.
Nach Hptl. Heiß
Der Teufelsfelsen im Perlbachtal
Damals, so erzählt die alte Sage, ist der Teufel leibhaftig umgegangen; und wo er den Leuten etwas antun konnte, hat er es gleich richtig getan.
Da hielten die Mitterfelser wieder einmal ihre Fronleichnamsprozession. Die ging damals noch durch das Perlbachtal bis zur früheren Pfarrkirche nach Kreuzkirchen. Das hat den Teufel arg gewurmt, die lange und festliche Prozession zu sehen. Und wie sie grad unterm „Hohen Stein“ vorbeizog, mischte der Böse unter das Geklingel der Ministranten noch eine andere Musik. Brocken um Brocken riß er vom Felsen ab und ließ sie krachend ins Tal kollern bis an den Bach. Der Schutz Christi aber war stärker als die Wut des Bösen. Die ganze Prozession ging ohne Schaden vorbei. Noch heute liegt dieses Felsengewirr unter dem „Hohen Stein“, den die Mitterfelser künftig den Teufelsfelsen nannten.
Nach Hptl. Heiß
Die Stiftung der Kapelle Kreuzkirchen
Die alte Jungfrau Adelheid von Runding weilte zu Besuch bei ihrem  Bruder Berthold, dem Burgvogt von Mitterfels. Auf dem Heimweg verirrte sie sich in den dichten Wäldern um Mitterfels. Schon legte sich abendlich dämmernd fahles Licht über die Bäume. Kreuz und quer den Wald durchstreifend, spähte sie nach der befreienden Lichtung. Verzweiflung nagte an ihrem Herzen, Schaudernd dachte sie an den Gedanken, in der Waldwildnis die Nacht zubringen zu müssen. Er preßte ihr in dieser Seelennot das fromme Gelübde ab, dort eine Kapelle zu erbauen, wo sie aus dem Walde fände. Wie als Antwort von oben vernahm sie bald darauf das Aveglöcklein des Klosters Oberalteich. Aufatmend ging sie dem Schalle nach und fand bei Kreuzkirchen aus dem Walde. Treulich hielt sie ihr Versprechen und ließ auf der Hügelzunge eine Kapelle erstehen, die sie samt einem Gute dem Kloster Oberalteich als Seelsorgekirche übergab.
Bruder Berthold, dem Burgvogt von Mitterfels. Auf dem Heimweg verirrte sie sich in den dichten Wäldern um Mitterfels. Schon legte sich abendlich dämmernd fahles Licht über die Bäume. Kreuz und quer den Wald durchstreifend, spähte sie nach der befreienden Lichtung. Verzweiflung nagte an ihrem Herzen, Schaudernd dachte sie an den Gedanken, in der Waldwildnis die Nacht zubringen zu müssen. Er preßte ihr in dieser Seelennot das fromme Gelübde ab, dort eine Kapelle zu erbauen, wo sie aus dem Walde fände. Wie als Antwort von oben vernahm sie bald darauf das Aveglöcklein des Klosters Oberalteich. Aufatmend ging sie dem Schalle nach und fand bei Kreuzkirchen aus dem Walde. Treulich hielt sie ihr Versprechen und ließ auf der Hügelzunge eine Kapelle erstehen, die sie samt einem Gute dem Kloster Oberalteich als Seelsorgekirche übergab.
Fassung nach Krinner
Ein „Vergelts Gott“
Ein Bauer aus der Haibacher Gegend fuhr einmal mit einem schwer beladenen Wagen Scheitholz nach Straubing. Es war Nacht geworden, eine rauhe und kalte Nacht, und der Sturmwind fegte über die Felder hinweg durch die Bäume, daß die Äste krachten. Bei Haselbach, auf der Distriktstraße, die von Kötzting nach Straubing , setzte sich ein unbekannter Mann in einen weiten langen Mantel gehüllt, ohne ein Wort zu sagen, auf die Langwied. Der Bauer war zum Reden eben nicht aufgelegt; ihm wäre es lieber gewesen, wenn er bei diesem Wetter bald eine warme Stube bekommen hätte, und zudem kam ihm der Fremde nicht sonderlich geheuer vor. Die Rosse zogen schnaubend an dem Wagen; es schien, als ob die Last immer und immer schwerer würde. Zu allem Unglück fiel dann etwa im Ortsbereich von Mitterfels auch noch der lange eiserne Nagel an der Achse aus dem Vorderrad und gerade noch zur rechten Zeit sah der Bauer das nahende Unheil. Gottlob blieben die Pferde sogleich stehen, sonst hätte sich das Rad losgemacht, und die schwere Holzfuhr wäre zusammengesunken. In seiner Not faßte der Bauer sich nun ein Herz und rief dem fremden Manne zu: „Geh ein bißchen zu mir vor, sei so gut, und hilf mir den Nagel suchen.“ In demselben Augenblick löschte ein Windstoß dem armen Bauern auch das Licht aus, das er in seiner Laterne hatte. Es war jetzt stockfinstere Nacht. Da richtete sich der Fremde auf, schüttelte sich in seinem Mantel, und dessen weißleuchtender Schein fiel auf die Straße, so daß sie weithin erhellt war. Ohne Mühe konnte der erschrockene Bauer den Nagel aufheben und steckte ihn mit einem „Vergelts Gott für die armen Seelen“ in die Achse. „Segne es Gott,“ murmelte der Fremde, „das ist mir noch abgegangen, jetzt bin ich erlöst.“ Mit diesen Worten verschwand der Fremde. Der Bauer aber, zu Tode erschrocken, fuhr mit seinem Wagen weiter nach Straubing, und es kam ihm vor, als ob die Pferde nur die halbe Last zu ziehen hätten.
Nach H. Kappel
Vom Schmied in Mitterfels
In Mitterfels war ein Schmied, dem ging’s hart an, und da hatte er’s gleich: er verschrieb sich dem Teufel. Der kam auch gleich und brachte ihm das Geld, und nun ging’s lustig weiter im Schmiedhaus.
Der alte Schmied hat schon nimmermehr drandenkt an seinen Vertrag. Da kommt einmal sein Weib in die Schmiede gerannt: „Du, da Deifi is drauß!“ Der Schmied ist nicht faul, er laßt sich schnell ein Stückl g’weichte Kreiden geben und tut schon dem „Besuch“ recht freundlich, tut als ob er sich dreingibt: „Aber so werd’s schier net pressieren!“ – und er möcht noch einen Wunsch erfüllt vor der Abreise in die Böll‘, eine saftige Birne von seinem selberpflanzten Birnbaum im Garten.“ Der Teufel springt gleich voraus in den Garten und auf den Baum hinauf und brockt die Birn. Da war aber der Schmied genauso flink und hat stracks um den Baum herum einen Kreis mit der g’weihten Kreid’n zogen. Da wollt der Teufel runter, da saß er fest, polterte, daß es ein Zeug hatte, aber der Schmied war so ruhig wie zuvor. Da hat’s der Teufel mit dem Betteln probiert, und wie er zum Schluß dem Schmied versprochen hat, ihm weiter seine Ruh zu lassen, da hat er den armen Teufel wieder runterlassen und den Kreis irgendwo „aufg’macht“.
Ein paar Jahre waren um, da war er schon wieder da, der Teufel: „Du gibst mir mei Geld von damals z’ruck oder dei Seel!“ Da hat der Schmied schö dasi tan, er soll sich einmal auf’n Augenblick in den Lehnstuhl setzen und gedulden und der Schmied selber lauft zur Kommod und zieht die obere Schublad’n. Da hat derweil dem Schmied sein Weib rund um den Stuhl einen Kreis mit der g’weichten Kreid’n zogn, so hatten’s die beiden schon immer ausgemacht, da hat der Teufel wieder krakeelt, aber hat schon gemerkt, er ist der Ausgeschmierte. Hat sich also wieder gut gegeben und dem Schmied Ruh und Frieden versprochen. Er ist aber doch noch ein drittesmal gekommen. Da hat man die Luft schon zittern und brausen gehört, die Schmiedleut haben sich gleich auskennt. Der Schmied ist nach einem Sack gesprungen und hat ihn ans Schlüsselloch gehalten. Da saust der Teufel nein und krubelt den Sack. Den halt aber der Schmied gut zu und legt ihn auf den Amboß und haut zu, und sein G’sell haut zu, und der Teufel wird windelweich. Wie er nur mehr gewinselt hat, hat ihn der Schmied und sein Gsell naus auf den Dunghaufen.
Es hat sich dann kein Teufel mehr in Mitterfels sehen lassen.
Nach Prof. Hans Karlinger
Die Sage vom Hüter von Gschwendt
Wenn im einsamen Gschwendtner Moos aus heimtückischen zottigem Grasland die Abendnebel steigen und die Nacht einzieht in das düster umrahmte abgelegene Tal, dann hört man, scheu und beunruhigend, wie ein Hilferuf aus tiefem Abgrund, den Hüter blasen – zwei, -dreimal, langgezogen, verhallend im Nebel, von den Menschen schaudernd vernommen und doch ungehört auf ewige Zeit.
Der Hüter hatte, als er im Gschwendtner Kircherl als Bub die hl. Kommunion empfangen hatte, in verstocktem Sinn die Hostie heimlich aus dem Mund genommen, sie daheim in seinen Hüterstecken gezwängt und damit nach seinem Vieh geworfen. Darum findet seine Seele keine Ruhe mehr, muß an den düsteren Tagen im Moos umgehen und blasen, wie um einen Hilferuf zu den Manschen zu senden.
Nach Franz Wartner
Die Franzosen in Haselbach
1809 waren die Franzosen in Haselbach. In Bruckhof waren Berittene im Quartier. Der Bruckhofbesitzer hatte ein Paar sehr schöne Pferde. Diese nahmen die Franzosen mit und ließen dafür zwei alte Klepper stehen. Während des Gottesdienstes kamen sie nach Haselbach. Als sie an der Kirche vorbeiritten, wieherten die Pferde. Der Knecht des Bruckhofbauern erkannte dieses Wiehern. Als er aus dem Gottesdienst kam, sah er in der Wirtsstallung nach, fand die Pferde band sie ab und trieb sie rasch durch das Hintertor in eine Waldschlucht bei Erpfenzell. Die Franzosen kamen wieder nach Bruckhof und suchten die Pferde, fanden sie aber nicht. So mußten sie die alten Klepper wieder mitnehmen.
Von Kr. Hans Baier
Tote, die sich rühren
In dem Hause, das gegenüber dem Mitterfelser Friedhof stand, es wurde 1983 abgerissen, waren im vorigen Jahrhundert einmal rechte Geizkrägen drauf: erzählt die Sage.
Die haben kein Holz kaufen wollen, sondern sind nachts naus auf die Straßen und haben die Totenbretteln zusammengepackt und damit eingeheizt. Da ist aber ein Gepolter losgegangen, als hätt das Haus kein Dach mehr und fuhr von oben aller Blitz und Hagel vom ganzen Jahr auf einmal herab. Das waren die Toten, die sich um ihre Brettl rührten, auf denen sie gelegen waren. Die Leut sind darauf bald gestorben.
Verfasser unbekannt
Wie der Teufel den Dachsberger Veitl mitnahm
In der ehemaligen Gemeinde Dachsberg steht ein ansehnlicher Hof der Familie Artmeier, der seit alten Zeiten nur der Dachsberger genannt wird. Auf diesem ehedem großen Gutshof wirtschaftete vor langer Zeit der Dachsberger Veitl.
Der Veitl war bei seinen Mitmenschen nicht immer beliebt, manche nannten ihn glattweg einen Lump. Er war zeitweise ein solcher Grobian, daß sich kein Mädchen fand, das Dachsbergerin werden wollte; und so schlug sich der Veitl als Lediger durchs Leben. Weil er die Kirche ganz selten von innen sah, aber wirtschaftlich gut dastand, munkelte die Bevölkerung, daß der Veitl mit dem Teufel im Bunde stehen mußte.
„Der Teufel hilft seinen Leuten, aber holen tut er sie auch“; so hieß es, wenn von Veitl die Rede war. Da trug stich etwas zu, das diese Redensart beinahe zur Gewißheit werden ließ. In einer bitterkalten Winternacht war das Mannsvolk aus Dachsberg am Ketzenweiher in der Bärengrube versammelt, um die die Eisstöcke krachen zu lassen. Der Vollmond spendete in der klaren Nacht ausreichend Licht und malte von den Bäumen gespenstische Schatten in den Ab- verschneiten Winterwald. Stunde um Stunde schlug die Kirchenuhr, und jetzt bei, erklang gerade die Mitternachtsstunde. Niemand dachte an das Heimgehen.“Veitl, du bist dran“, ging der Ruf durch die Runde. Aber vom Veitl war plötzlich nichts zu sehen. „Der war doch grad noch da“, meinte einer. Alle schauten sich um und riefen nach ihm. Vom Veitl keine Spur! Niemand hatte gesehen, den. daß sich der Veitl etwa heimlich verdrückt hätte. Der Veitl war einfach verschwunden, wie weggezaubert. Da ließ einer die Bemerkung fallen: „Den wird doch net der Deife gholt ham?“ Eiskalt lief es da den Eisstockschützen auf diese Worte hin den Rücken hinunter. Sogleich schulterten sie ihre Eisstöcke und machten sich wortlos auf den Heimweg.
Eine „wirkliche“ Begegnung mit dem Teufel hat der Dachsberger Veitl schriftlich festgehalten, und zwar auf einer Holztafel. Diese befand sich bis vor etwa 150 Jahren an einem Nußbaum bei Perasdorf und trug die Inschrift: „Auf die Anrufung des hl. Laurentius ließ mich hier der Teufel fallen.“ Über den Ursprung es- dieser Tafel berichtet die Sage:
Der Dachsberger Veitl hatte seine Ochsen auf den Viehmarkt nach Schwarzach getrieben und, wie er meinte, gut verkauft. Mit einem schönen Batzen Geld im Sack machte er sich auf den Heimweg. Zu Degenberg lenkte er seine Schritte ins Wirtshaus, um Einkehr zu halten. Ein paar Stammtischbrüder hatten gleich herausgefunden, daß der Veitl gut bei Kasse war. Schon schallte es durch die Gaststube: „Wirt,f s Gebetbüchl her!“ Und sogleich machten die Spielkarten die Runde. Der Veitl konnte es anstellen wie er wollte, er verlor Spiel um Spiel. Krug um Krug ließ er sich vorsetzen und versuchte, seinen Ärger hinunterzuspülen. Als es auf Mitternacht zuging, hatte er seine ganze Barschaft verspielt. Unter gotteslästerlichen Flüchen und teuflischen Verwünschungen torkelte er aus dem Wirtshaus.
Der Wind ließ die Blätter der Bäume rauschen. Und mit diesem Rauschen nahte auch der Teufel. Als Strafe für sein Fluchen packte der Satan den Veitl und trug ihn mit sich fort durch die Lüfte. Der Dachsberger Veitl erkannte die ist Gefährlichkeit seiner Lage und glaubte schon, daß sein letztes Stündlein ihr geschlagen hätte. Blitzartig leuchtete ihm da sein bisheriges Leben auf. Wenig Pluspunkte auf der rechten Waagschale, aber viele Schlechtigkeiten auf der linken Schale der Waage! „Armer Veitl, wenn jetzt abgerechnet wird“, konnte er noch murmeln.
Da sorgte – ganz ungewollt – der Lehrer von Perasdorf für seine Rettung. Der Lehrer war bis Mitternacht in heimischen Wirtshause gesessen und hatte mit einigen Zechern über Gott und die Welt geredet. Jetzt machte er sich auf den Heimweg. Und weil er dem braunen Naß allzu kräftig zugesprochen hatte, läutete er jetzt um Mitternacht schon den Tag an, um dann ruhig bis zur Frühmesse schlafen zu können.
Diese Zeitverschiebung rettete den Veitl aus den Klauen des Höllenfürsten. Als der Veitl nämlich die Glockentöne vernahm, flehte er den hl. Laurentius, den Kirchenpatron von Perasdorf, um Hilfe an. Völlig verwirrt ob des Geläutes zu so ungewollter Stunde ließ der Satan den Veitl fallen. Und der landete bei dem eingangs erwähnten Nußbaume. Zum Danke für die wunderbare Rettung aus den Fängen des Teufels ließ der Dachsberger Veitl an jenem Baume die Tafel mit der genannten Inschrift anbringen.
(Vergleiche auch die Sage „Das Marterl bei Ay“ auf Seite 37)
Von Sigurd Gall
Die Krallen des Teufels
Von Uttendorf in der Gemeinde Haselbach führte bis einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein Weg über den Köglberg nach Buchberg in der Gemeinde Mitterfels. Der Weg ist heute mit Wald bewachsen, stellenweise ist er noch als Feldweg in Benützung. An der Scheitelstelle des Weges, auf dem Köglberg, stand noch viele Jahre nach dem Krieg ein Feldkreuz. Heute liegt er zerbrochen am Feldrain. Dieses steinerne Kreuz weist einige rillenartige Vertiefungen auf, im Volksmund die Krallen des Teufels geheißen. Die Sage berichtet über die Entstehung der Teufelskrallen:
Auf dem Einödhof in Kögl wirtschafteten immer fromme Leute. Dies wurmte den Teufel. So versuchte er mit allerlei Ungemach den Leuten dreinzupfuschen und sie von der frommen Denkweise abzubringen. „Das beste Mittel dazu ist, wenn ich mit Sturmgebraus über die Felder fahre und das Getreide niederwalze“, dachte der Teufel. Dieses Vorhaben führte auch mehrmals aus. Um weiteren Schaden abzuwenden, errichtete der Köglbauer ein Feldkreuz. Als das Getreide in vollen Ähren stand, stürmte der Teufel wieder gegen den Köglberg, um sein Unwesen zu treiben. Plötzlich gewahrte er das Feldkreuz. Unbändige Wut packte ihn. Mit aller Gewalt setzte er seine Pranken an das steinerne christliche Siegeszeichen, um es zu stürzen. Da erklangen die Kirchenglocken und riefen zum Gebet. Die Macht des Teufels war gebrochen. Dort, wo er seine Pranke an den Stein setzte, sind heute noch „die Krallen des Teufels“ zu sehen.
Von Sigurd Gall
Die Katherlwiese
Vor vielen Jahren war ein Bauer von Thurasdorf mit seinen Mägden auf einer Wiese beim Heuen. Die Bäuerin brachte ihnen die Mittagssuppe auf die Wiese. Als sie abends heimgingen, vergaßen sie die Schüssel mitzunehmen. Da fragte der Bauer, wer die Schüssel holen wollte. Weil es schon Nacht war, fürchteten sich alle und niemand meldete sich. Da versprach der Bauer der Magd Kathi ein Paar neue Pantoffel, wenn sie die Schüssel holen würde. Katherl lief fort. Sie kam nicht mehr. Lange warteten sie daheim auf die Magd. Auf einmal flog ein Fenster auf, und der Teufel hielt einen abgehauenen Fuß vom Katherl zum Fenster hinein und schrie: „Jetzt könnt ihr dem Katherl Pantoffel anmessen lassen!“
Verfasser unbekannt
Vom Haibacher Schloßberg zum Gallner
Die Schweden in Haibach
Nachdem die Schweden im Dreißigjährigen Krieg am 28. November 1633 die Stadt Straubing erobert hatten, stand ihnen nunmehr ganz Niederbayern offen. Ohne noch irgendwo auf einen nennenswerten Widerstand zu stoßen, konnten sie jetzt donauabwärts bis Passau oder nach Norden hin in den Bayerischen Wald vordringen und diese ganze Gegend mit Raub, Mord und Plünderung heimsuchen.
Ihre besondere Aufmerksamkeit aber galt in dieser Gegend dem Abte des Klosters Oberalteich Veit Höser, denn von ihm erhofften sie das Versteck, in dem die Kostbarkeiten des Klosters untergebracht waren, zu erfahren. Der Abt hatte `sich jedoch mit seinen Mönchen rechtzeitig vor dem Überfall der Schweden auf das Kloster in Sicherheit bringen können und hatte vorübergehend im Pfarrhaus von Elisabethszell Unterkunft gefunden.
Frater Ambrosius, der sich in der Nähe des Klosters versteckt gehalten hatte, berichtete seinem Abt den Überfall der Schweden wie folgt: „Gestern nacht näherten sich plötzlich mehr als tausend schwedische Reiter und ein Teil davon drang in unser Kloster ein. Sie durchsuchten und durchwühlten alle Zimmer und Kammern, die Ställe und Scheunen, ja selbst in die Kirche kamen sie auf ihren Pferden geritten und machten daraus einen Roßstall. Unter Lärmen und Schreien schlugen sie Kisten und Kästen auf, rissen Bilder von den Wänden, warfen Bücher und Schriften von den Regalen und hausten wie die Wilden. Einige hoben sogar die Steintafeln von den Gräbern weg, zogen die Leichname heraus und verunstalteten und verunehrten alles.
Indessen hatte sich der größte Teil der Reiter fast lautlos dem Markte Bogen genähert, die aufgestellten Wachen überrumpelt und sie mit dem Tode bedroht, wenn ihnen nicht gleich der Weg über die verrammelte Brücke freigemacht würde. Dadurch erschreckt, öffneten ihnen die Wachen den Zugang, und im Nu war der Markt mit Schweden voll. Sie erbrachen die Haustüren, wenn ihnen nicht ohne Verzug geöffnet wurde und wüteten überall mit Rauben und Stehlen.“ Wer vermag die Angst, Furcht und Schrecken der so plötzlich Überfallenen zu schildern? Frauen und Kinder liefen schreiend aus den Häusern und wußten nicht, wohin sie sich wenden könnten. „Dann machten sie sich auf den Weg zum Bogenberg, wo sie ebenfalls nach ihrer Gewohnheit hausten. Sie schlugen die Kirchentür ein und drangen auch noch in die Schatzkammer, wo allerlei kostbare Gaben der frommen Wallfahrer aufbewahrt waren.
Die Brüder und Dienstleute vom Bogenberg hatten die anrückenden Feinde früh genug bemerkt und sich in Sicherheit bringen können. Nur der Pater Sebastian Oberer wollte lieber den Tod erleiden, als seinen ihm anvertrauten Platz verlassen. Ihn fanden die Schweden in der Kirche, betend vor dem Altare liegen, rissen ihn herum und stießen ihn mit dem Flintenkolben, und weil er nicht weichen wollte, schlugen sie ihm die vom Altar geraubten Leuchter über den Kopf. Wie er nun so blutend lag und seine Peiniger um den erlösenden Tod bat, spien sie ihn an und drohten ihm noch Ärgeres an.“
Doch die Feinde drangen immer weiter in den Bayerischen Wald vor. Anfang Dezember des Jahres 1633 suchten sie die Schlösser Au, Steinburg, Pürgl, Haggn und Haibach heim, und verwüsteten und zerstörten sie fast vollständig. Nun war auch Elisabethszell keinen Tag mehr sicher. Der Abt hielt sich deshalb den ganzen Tag über im Freien auf und bestieg mehrmals am Tage die obersten Höhen der umliegenden Berge, wo er das Anrücken der Feinde schon von ferne beobachten konnte. Als er von allen Seiten berittene Landsknechte auf das Dörflein Elisabethszell anrücken sah, beschloß er, auch die Nacht in den verschneiten Wäldern zu verbringen, wo er immer wieder auf Geflüchtete und Versprengte stieß, die sich an einem Feuer wärmten.
Als es dunkelte, schienen dem Abte die offenen Feuer zu gefährlich, weil der weithin sichtbare Schein sie verraten könnte. Er entfernte sich heimlich und nahm einen Schneider als Gefährten mit sich. Beide erstiegen eine andere Höhe und fanden da, auf dem heutigen Frauenstein, einen Unterschlupf, wo sie sich verbergen konnten. Es war eine Höhle, die dem Abte ein genaues Abbild von der zu sein schien, in die sich einst der hl. Benedikt zurückgezogen hatte. Auf der einen Seite ragte eine glatte Felswand empor und darüber lag eine ungeheuere Steinplatte, die ein sicheres Dach bot.
Der Wind hatte Schnee in die Höhle geweht und es war darin bitter kalt. Dazu wurden die beiden von Hunger und Durst gequält, weil sie den ganzen Tag durch die Wälder geirrt waren. Abt Veit Höser kam sich in dieser Verlassenheit wie ein Einsiedler vor, von denen in heiligen Geschichten viel erzählt wird.
Doch die Not macht erfinderisch und sein Sinnen ging vor allem dahin, wie man sich vor der zunehmenden Kälte schützen könnte. Da der Schneider eine Flinte bei sich trug, hieß ihn der. Abt Moos und dürres Reisig sammeln, Pulver darauf zu streuen und aus dem Flintenschlosse Feuer auf den bereitgelegten Zunder zu schlagen. Endlich brannte das dürre Zeug, aber nun quälte sie das Verlang
en, etwas zu essen. Der Schneider schlich sich daher zur nächtlichen Stunde in den Pfarrhof von Elisabethszell, wo alle außer einem Dienstboten und der Köchin dem Haus entflohen waren. Nach etwa anderthalb Stunden kam er in die Höhle zurück, reichlich beladen mit Brot und Fleisch.
Um Mitternacht erschienen einige Verirrte bei der Höhle, von der sie den Feuerschein wahrgenommen hatten. Unter ihnen befand sich Baron von Poyßel mit seiner ganzen Familie, der aus seiner Hofmark Haunkenzell hatte fliehen müssen und der junge Herr der Hofmark Felburg. Der Abt sah, daß sie am Ende ihrer Kräfte waren und überließ ihnen den Platz am wärmenden Feuer in der Höhle. Sie aber schlugen den Weg nach Haibach ein und näherten sich wie Diebe in der Nacht dem Pfarrhaus. Durch die nur angelehnte Tür traten sie ein, doch alle Stuben waren menschenleer, denn auch die Haibacher verbrachten diese Nacht in den verschneiten Wäldern. Als am frühen Morgen der Haibacher Pfarrer eintrat, staunte er sehr über seine Gäste, die er anfangs gar nicht erkannte, denn auch der Abt trug bäuerliche Kleidung. Es kam aber kein gutes Gespräch zustande, denn einer wie der andere wußte nur von Not und Jammer zu berichten.
Draußen auf der Straße sahen sie den Wundarzt in eiliger Geschäftigkeit von Haus zu Haus laufen. Er verstand außer dem Bartabkratzen und Haareschneiden auch allerlei Heilkunst; so konnte er Zähne ziehen, Wunden nähen und verbinden und verrenkte Glieder wieder einrichten. Solcher Kunst bedurften in Kriegszeiten sowohl Freund als auch Feind, und daher konnte sich der Wundarzt in der ganzen Umgebung ziemlich frei bewegen. So rief der Abt den Wundarzt herbei, weil er meinte, bei ihm am sichersten unterschlüpfen zu können, da man bei ihm am wenigsten einen Überfall zu fürchten hätte. Schweren Herzens trennte sich der Abt von seinem Gefährten und begab sich in das recht heimelige Dachkämmerchen im Hause des Wundarztes. Wehmütige Freude überkam ihn, als er sich nun geborgen wieder unter einem Dache befand und hoffen konnte, wenigstens für einige Zeit Ruhe und Sicherheit zu finden (im heutigen Anwesen Haus Nr. 11, Bes. Hans Grimm).
Doch auch diese Ruhe und Geborgenheit sollte nicht von langer Dauer sein. Kaum hatte der Abt über eine Stunde in seinem Stübchen geruht, als draußen im Dorf unverhofft ein gewaltiges Jammer- und Klagegeschrei erscholl und der Lärm vermehrte sich noch durch den Sturmruf der Kirchenglocken. Vorsichtig spähte der Abt aus dem Fenster. Einige Reiterscharen kamen auf das Dorf zu, umzingelten es und stürmten dann in die Häuser, fielen über die flüchtenden Menschen her und plünderten und raubten, was ihnen in die Hände fiel. Wer es vermochte, verließ in größter Eile über Kronwitt das Dorf, um sich von dort in den Wald zu retten.
Auch im Hause des Wundarztes liefen alle weg, ohne an den Abt zu denken, den sie in Angst und Schrecken allein ließen. Obwohl ihm das Haus noch unbekannt war, gelangte er über eine Leiter auf den Dachboden, kletterte ganz oben durch das Dachgebälk, kroch von dort in ein Nebengebäude und versteckte sich unter dem Firste in einem finsteren Winkel. Unterdessen hörte er, wie die Schweden die Türen im Hause aufsprengten und mit Äxten sich Zugang zu den Schränken verschafften. Ruhig, ohne nur ein Glied zu bewegen, lag der Abt in seinem Versteck. Aber sein Herz schlug heftig, das konnte er nicht bändigen.
Da fiel ihm ein, daß. er in einem Beutel noch einen ansehnlichen Geldbetrag und auf seiner Brust das kostbare, mit Edelsteinen verzierte Prälatenkreuz trug. Daran hätten ihn die Feinde, trotz seiner bäuerlichen Kleidung sicher erkannt. Ganz vorsichtig schob er daher Kreuz und Geld zur Seite hinter einen Balken, denn er rechnete fest, daß man ihn bald entdecken würde. Fluchend und lärmend polterten die Schweden die Treppe herauf und er hörte sie in seinem Stübchen rumoren. Gleich würden sie auf dem Dachboden erscheinen, um auch diesen zu durchstöbern. Doch da erscholl auf dem Dorfplatz ein mehrmaliges Trompetensignal und am Getrampel erkannte der Abt, daß die Plünderer das Haus verließen. Durch einen Dachritz konnte er beobachten, wie sie mit Beute beladen die Häuser verließen und bald darauf aus dem Dorfe abzogen.
Es dauerte aber noch eine gute Weile, bis die Einwohner aus dem Walde zurückkehrten und auch der Abt aus seinem Versteck hervorkommen konnte. Nun sah er mit eigenen Augen, wie die Schwedenhorde gewütet, Türen und Schränke eingeschlagen, Schubladen und Kisten ausgeplündert und alles, was sie nicht mitnehmen konnten, zerbrochen, zerhackt und durchlöchert hatten.
Drei Tage später kam ein Bote atemlos von Elisabethszell nach Haibach und berichtete dem Abt, daß die Schweden nun auch die Probstei und das Dorf Elisabethszell überfallen und vollständig ausgeraubt und fast alles zerstört hätten. Dies war am 19. Dezember geschehen und der Bote berichtete neben vielen anderen Untaten von schauerlichen Grausamkeiten. Von dem schwedischen Trunke, bei dem sie ihre Opfer auf dem Boden fesselten und ihnen dann Jauche in den Mund gossen, bis der Bauch unförmig aufschwoll. Dann hüpften sie auf den Bauch dieser Gemarterten, bis die übelriechende Flüssigkeit in hohem Bogen wieder aus dem Schlund herausspritzte. Auch hätten sie Stränge von leinenen Schnüren um den Kopf ihrer Opfer gelegt, einen Stock zwischen die Schnüre gezwängt und dann immer ärger zusammengedreht, bis den Gequälten die Augäpfel auf ganz abscheuliche Art hervorquollen.
Der Abt erkannte, daß hier seines Bleibens nicht mehr länger sein konnte und mit Hilfe; des Wundarztes von Haibach gelang es ihm auch, diese bedrohte Gegend zu verlassen.
Von Walter Ritschl

Der Obermüllner und der Oberalteicher Kirchenschatz
Zu den ältesten Mühlen im Menachtal zählt die Obermühle. Von einem früheren Besitzer in der Zeit nach dem 30jährigen Krieg erzählte man sich wahre Schauergeschichten. Er soll mit dem Teufel ein Bündnis geschlossen und dafür ein Schwarzbuch und einen Erdspiegel erhalten haben. Als die Schweden in unserer Gegen hausten, steckten die Mönche von Oberalteich die Schätze ihrer Kirche in eine Truhe und fuhren damit nachts in den Wald. Auf dem Wege von Haibach nach Elisabethszell merkten sie, daß sie von den Schweden verfolgt wurden. Schnell bogen sie vom Fahrweg ab und vergruben die Truhe im nahen Wald, der heute noch den Flurnamen Ramelholz führt. Niemand erfuhr etwas von dem geheimen Schatz, bis ihn der Obermüller mit seinem Erdspiegel entdeckte. Damit kann man nämlich ohne Mühe alle Schätze unter der Erde entdecken. Aus seinem Schwarzbuch wußte er, wie man solch einen Schatz heben muß: Nur im Winter, in einer der drei Rauhnächte, am besten in der Dreikönigsnacht, kann der Schatz gehoben werden. Sechs Männer müssen dabei sein und keiner darf einen Laut von sich geben!
Schon ging alles ganz gute und die Truhe war fast an der Erdoberfläche, als plötzlich ein wildfremder und unheimlicher Mann durch den Wald gelaufen kam und rief: „Obermüller, dein Haus brennt!“ Dem Müller entschlüpfte ein Schreckensruf, das Schweigen war gebrochen. Die Truhe war wieder verschwunden und seitdem hat niemand mehr etwas davon gesehen. Nur in den Rauhnächten sieht man bisweilen ein Flimmern und Leuchten durch den Wald.
Nach Walter Ritschl
Der Obermüller und die Schweden
Ein andermal kamen die Schweden zur Obermühle und der Müller mußte mit seinen Leuten fliehen. Sie versteckten sich im Pfarrholz auf der nächsten Anhöhe. Die Schweden hausten in der Mühle. Nahts aber schlich sich der Obermüller zu seinem Anwesen, fütterte das Vieh und holte Lebensmittel. Bald merkten dies die Schweden, legten sich auf die Lauer und verfolgten ihn. Auf der Loderwiese holten sie ihn ein und schlugen mit ihren Säbeln auf ihn los. Der Obermüller aber war ein starker Mann und wehrte sich tapfer. Als er einige Schweden niedergeschlagen hatte, wandten sich die anderen zur Flucht.
Der Obermüller aber begrub einen toten Schweden gleich an Ort und Stelle und deckte sein Grab mit einer Steinplatt zu. Heute noch liegt in der Mitte der Loderwiese, deutlich sichtbar, die regelmäßige Steinplatte.
Nach Walter Ritschl
Der Obermüllner und der Teufel
Eine andere Geschichte erzählt vom Obermüller, daß er an einem Sonntag beim Kirchgang nach Haibach vergessen hatte, sein Schwarzbuch wegzuschließen. Unruhig wartete er auf das Ende des Gottesdienstes und ohne beim Branntweinkramer einzukehren, eilte er nach Hause. Als er die Stubentüre aufriß, war das Unglück schon geschehen. Die ganze Stube war voll von Teufeln. Der Müllerbursche hatte das Schwarzbuch erwischt und darin gelesen. Je mehr er las, umso mehr Teufel erschienen. Er konnte sich nicht mehr helfen und die Teufel wollten ihn und der Obermüller mitnehmen. Dieser aber handelte mit den Teufeln und sie gingen auf eine Wette ein: Der Müller schüttete einen Sack voll Hirse in die Badstube, den die Teufel wieder zusammenklauben sollten. Er wolle inzwischen das Schwarzbuch rückwärts lesen. Wer früher fertig sei, habe gewonnen. – Flugs waren die Teufel ’n der Radstube und der Müller begann zu lesen. Er getraute sich kaum mehr zu schnaufen, so eilig hatte er es mit dem Lesen und wurde auch fertig. Die Teufel hatten verloren und verließen unter großem Gepolter, das bis nach Haibach zu hören war, die Mühle.
Nach Walter Ritschl
Wie der Teufel den Schloßherrn von Haibach holte
Im Tal der Menach vor dem Lanzlberg und Landasberg stehen auf einem bewaldeten Hügel die Reste eines stolzen Schlosses. Einem Totengerippe gleich grinsen die bleichen Wände mit den leeren Fenstern in das Tal hinab. Blutrot erglühen die Mauern in der Abendsonne, als wollten sie künden von dem grausamen Manne, der einst da droben hauste.
Jahrhunderte ist’s her, da saß hier ein gar stolzer und gestrenger Herr. Wehe dem Hörigen, der nicht auf den Tag den Zehent seinem Grundherrn entrichtete! Man warf ihn in den Turm. Wehe dem, der die strengen Gebote seines Herrn mißachtend, die alte Forderung der Bauern: „Frei Fisch, frei Wild!“ in die Tat umsetzte! In einen Sack genäht warf man ihn in den tiefen Schloßweiher. Da könne er sich  dann an den Fischen ergötzen. Und den, der sich am Wild vergriff, band man mit Stricken an das Geweih eines Hirschen und trieb das Tier durch Dickicht und Dorn, bis dem Frewler das Fleisch in Fetzen vom Leibe hing. Aber die Strafe blieb nicht aus.
dann an den Fischen ergötzen. Und den, der sich am Wild vergriff, band man mit Stricken an das Geweih eines Hirschen und trieb das Tier durch Dickicht und Dorn, bis dem Frewler das Fleisch in Fetzen vom Leibe hing. Aber die Strafe blieb nicht aus.
Schweres Siechtum befiel den Grausamen. In langen Nächten floh ihn der Schlaf. Jahre hindurch in den Lehnstuhl gebannt. tat er endlich seinen letzten Seufzer. Alter Sitte getreu trugen ihn seine Knechte zu Tal. In der Kirche des Dorfes sollte er auf der Bahre liegen und dort seine letzte Ruhestätte finden. Nicht schwer war die Bürde, die sie trugen. Die Jahre der Krankheit hatten den Körper aufgezehrt. Doch der Weg ging gach zu Tal und die Träger wollten sich verschnaufen. An einer Wegbeuge machten sie Rast und stellten die Totentruhe ab. Da plötzlich hörte man in den Lüften ein Stöhnen und Ächzen und Wehklagen. Die alte Burglinde und die Bäume rundum schüttelten die Aste, und doch spürte man nicht den Hauch eines Windes. Eine Schar schwarzer Krähen umflatterte mit heiserem Krächzen die Knechte. Die aber flohen entsetzt, und kehrten erst wieder, da sie das Stöhnen und Ächzen und Wehklagen nicht mehr vernahmen. Als sie aber den Sarg wieder auf die Schulter hoben, da waren sie baß erstaunt. Noch leichter, ganz leicht war ihre Bürde geworden! Und es sprach einer zum andern, von wannen das komme? Und weil niemand Rat wußte, faßten sie Mut und lüpften der Truhe Deckel. Und wie sie auch suchten und sich mühten: Leer war der Schrein, nichts fanden sie mehr von ihrem toten Herrn. Der Gottseibeiuns hat ihn zur Hölle entführt! Dort muß er seine Sünden büßen in ewiger Verdammnis.
Von Justizrat Alfons Prager, 1925
Zur Geschichte: Bei dem oben genannten Schloßherrn handelt es sich um den letzten Ossinger, der 1797 verstarb und keinen männlichen Nachkommen hinterließ.
Der Schneider und der fremde Mann
Ein Schneider war bei einer Bäuerin auf der Stör. Sie schüttete wenig Rahm in das Butterfaß und begann auszubuttern. Das sah der Schneider und meinte: „Mit so wenig Rahm wirst du kaum Butter zusammenbringen!“ Die Bäuerin sagte nichts darauf, griff zum Dachbalken und holte eine Schmiere herunter. Damit rieb sie die Kurbel des Butterfasses ein. Dann rührte sie weiter. Nach kurzer Zeit war das Faß voll Butter. Der Schneider staunte nicht wenig darüber, und als die Bäuerin für einen Augenblick die Stube verließ, nahm er etwas von dieser Schmiere. Daheim angekommen rief er gleich seiner Frau zu: „Bring das Butterfaß und schütte etwas Rahm hinein!“ Er bestrich hierauf die Kurbel mit der mitgebrachten Salbe und nach kurzer Zeit war im Faß eine Menge Butter. Am nächsten Tag war ein Sonntag. Und während die Schneidersfrau in die Kirche zum Hochamt ging, mußte der Schneider das Haus hüten. Als er allein in der Stube saß, ging plötzlich die Türe auf. Ein Mann mit einem Buch trat herein und sprach:
„Willst da meine Künste reiben,
mußt du hier deinen Namen schreiben!“
Erschrocken suchte der Schneider nach Feder und Tinte, suchte und suchte, fand aber keine Tinte. Dann schnitt er sich in einen Finger und tauchte die Feder in sein Blut. Dann besah er sich das Buch und las darin auch den Namen der genannten Bäuerin. Er begann nun zu schreiben – aber nicht seinen Namen – sondern das Wort Jesus. Sogleich wurde das Buch immer schwerer und schwerer, es konnte nicht mehr gehoben werden. Der fremde Mann konnte sich nicht mehr von der Stelle rühren. Da kam die Schneiderin und sah was in der Stube vorging. Sogleich ging sie zum Pfarrer. Der betete und sprengte Weihwasser in die Stube. Da war der Fremde mit seinem Buch plötzlich verschwunden.
Aus „Haibacher Flur“ der Volksschule Haibach
Den Kopf abgeschnitten
In Kogl in der Gemeinde Neukirchen wars. Jung verheiratete Eheleute konnten sich gar nicht recht miteinander vertragen. Der Mann trank zu viel und die Frau ratschte zu viel. Sie konnte kein Geheimnis für sich behalten; nicht einmal die intimsten Familiengeheimnisse konnte sie verschweigen. Stets ging sie zu den Nachbarinnen in den Roigarten und ratschte alles aus. Dies verdroß den Mann sehr und er dachte darüber nach, wie er seiner Frau diese Untugend abgewöhnen könnte. Da kam er wieder einmal spät vom Wirtshaus heim, beladen mit einem großmächtigen Rausch. Als er durch seinen Hof dem Hause zuging, fing der Hahn zu krähen an und verkündete eine frühe Morgenstunde. Voll Wut über diesen Schreier, der ihn verriet, schnitt er dem Hahn den Kopf ab. Sogleich fiel ihm ein Plan ein, wie er seine Frau kurieren könnte.
Er ging mit verstörtem Wesen in die Schafkammer und seiner Frau fiel auf, daß er anders war als sonst. Da muß was geschehen sein, dachte sie und ließ nicht los, den Mann auszufragen, was denn geschehen sei. Endlich sagte der Mann ganz still und heimlich: „Ich will es dir sagen, wenn du mir versprichst, niemanden davon nur ein Sterbenswörtchen zu verraten – es hatte ja niemand gesehen – weiß somit kein Mensch, daß ich einem den Kopf abgeschnitten habe.“ Schauer durchfuhr seine Frau. Aber schon am nächsten Morgen wanderte sie in der Nachbarschaft herum und vertraute allen ihr Geheimnis an. „Aber ja nichts sagen,“ war stets ihr Schluß. Das gerade sickerte immer weiter bis nach Mitterfels durch. Es hörten davon die Gendarmen und sie kamen und kontrollierten nach. Der Bauer wurde vernommen und gestand, den Kopf seines Gockels abgeschnitten zu haben. Da wurde die Frau, die dieses Gerede auseinandergeratscht hatte, tüchtig ausgelacht. Sie schämte sich und ging nicht mehr zur Sitzweil in die Nachbarhäuser. Sie behielt fortan ihre Geheimnisse für sich selbst. Dies gefiel dem Mann, und er ging nicht mehr so oft ins Wirtshaus. Beide lebten fortan friedlich und glücklich weiter.
Verfasser unbekannt
Den eigenen Mann aufgehängt
Wieder war es in Kogl. Zwei Eheleute konnten sich gar nicht recht vertragen. Die Frau hatte gar keine Liebe zu ihrem Manne und dachte oft: „Wenn ich ihn nur los hätte!“ Dies merkte der Mann und wollte mit ihr einen Spaß treiben. Eines Tages saß er in der Stube auf seiner Haislbank, die er zum Holzschuhmachen immer brauchte. Eine Menge Besenreisig lag vor ihm. Er hielt einen Strick in der Hand und war gerade daran, Besen daraus zu machen. Da fing er zu jammern an: „Ich bin gar nicht mehr gerne auf der Welt, wenn nur Schluß wäre mit mir!“ Wie da die Frau horchte! Er redete weiter: „Ich wäre gerne bereit, meinem Leben ein Ende zu machen, wenn mir nur jemand dabei helfen würde!“ Da jubelte schon die böse Frau in ihrem Herzen und sagte: „Wenn du das willst, so kann ich dir schon helfen. Was soll ich tun?“ – „Sieh diesen Strick!“ sagte der Mann, „dem mache ich eine Schlinge und darein lege ich meinen Kopf. Du mußt nur den Strick, den ich durch die Decke stecke, oben in der Bodenkammer hochziehen. Aber zieh ja recht fest und hoch, damit ich mit den Füßen nicht mehr auf den Boden kann. Hernach mach dich schnell aus dem Staube, dann bist du es nicht gewesen; ich selbst habe mich dann erhängt“ Das böse Weib sprang rasch auf die Bodenkammer hinauf und fing gleich am Strick zu ziehen an. Der Mann steckte aber nicht seinen Kopf durch die Schlinge, sondern hing die Schnitzbank da an und sah zu, wie sich sein Weib plagte und die Bank bis an die Decke hochzog. Als das böse Weib glaubte, ihr Mann könnte nun tot sein, ließ sie den Strick los. Unter großem Gepolter sauste die Schnitzbank zu Boden. Die Frau eilte die Treppe hinunter und wollte schon das Weite suchen. Die Neugier zwang sie jedoch, noch einmal schnell in die Stube zu sehen. Wie staunte sie aber, als sie die Holzbank in der Schlinge erblickte. Ihr Mann stand hinter der Türe, packte sie schnell am Arm, zog sie in die Stube und prügelte sie tüchtig durch, damit sie merke, daß noch Leben in ihm sei. Sie schämte sich und war doch im Herzen froh, daß sie keinen Mord auf dem Gewissen hatte. Beide wurden noch recht glückliche Eheleute.
Verfasser unbekannt
Zu den heiligen Gütern
Droben in Mitterkogl ist ein Wald, der den Namen „Zu den heiligen Gütern“ führt. Vor vielen Jahren wurden einmal die heiligen Kirchengüter in der Pfarrkirche zu Haibach geraubt und da droben vergraben. Alle 100 Jahre zeigen sie sich, so erzählt die Sage. Werden aber wiederum Kirchengüter in der Pfarrkirche gestohlen, so zeigen sie sich auch außerhalb dieser Zeit.
Es war im Herbst 1943 an einem Sonntag. Die Austraglerin Franziska Steger suchte in aller Frühe nach Schwammerln, streifte durch die großen Waldungen und kam so „Zu den heiligen Gütern“. Immer schönere Pilze fand sie und plötzlich sah sie unter aufgehäuften Steinen zwei Schüsselchen aus purem Gold. Die glänzten wie die hl. Kelche in der Kirche. Freudig erzitterte ihr Herz. Schon wollte sie nach diesen herrlichen Schalen greifen. Aber weil ihre Hände von den vielen Schwammerln, besonders von den Schafhäuterln, unrein waren, wischte sie ihre Hände an ihrer Schürze ab, wischte und wischte; denn so große Pracht darf nur mit reinen Fingern berührt werden. Da fing das Glöcklein der Haibacher Kirche zu klingen an und rief die Leute zum Sonntagsgottesdienst. Beim ersten Klang der Glocken war die Herrlichkeit verschwunden. Dem Weibchen zitterten die Knie, die Haare standen zu Berge und schnell eilte sie nach Hause.
Verfasser unbekannt
Der Hirtenbub und der Teufel
Ein Hirtenbub mußte abends Gras aus dem Schuppen zum Füttern holen. Da kam der Teufel zu ihm. Er versprach ihm einen großen Sack Geld, wenn er neun Tage lang kein Weihwasser nehme, sich nicht wasche, nicht bete, sondern fluche und schelte. Diesen Vorschlag machte der Teufel dem Hirtenbub öfters und den anderen Dienstboten fiel es auf, daß der Hütjunge sich immer so lange im Schuppen aufhielt.
Sie befragten ihn darüber und er gestand, mit dem Teufel ein Bündnis zu haben. Nun hörte man den Buben nicht mehr beten, er wusch sich nicht mehr und fluchte wie ein Rohrspatz.
Die Bäuerin bemerkte auch die Veränderung und tadelte ihn: „Schämst du dich nicht, mit dem Teufel einen Handel zu treiben!“ Sie besprengte ihn mit Weihwasser. Sofort fing ein heftiger Sturm an. In der Nacht, als der Bub in seinem Bette unter dem Dache schlief, trug ein mächtiger Sturm die ganzen Dachziegel davon. Ein schwarzes Eichkätzchen erschien darauf wiederholt am Hof und jammerte und klagte.
Verfasser unbekannt
Die Kirche auf dem Gallner
In alter Zeit, als in Deutschland durch verheerende Krankheiten und Kriegswirren große Not herrschte, war die Kirche auf dem Gallner so verwahrlost, daß sie als Schafstall verwendet wurde. Nun diente beim Gallnerbauern zu dieser Zeit ein Hirtenknabe. der sehr frommen Sinnes war. Diesem tat es weh, daß das uralte Gotteshaus so erniedrigt wurde.
Als er die Schafe wieder einmal in die leere Kirche trieb, hörte er von  vorne, wo der Altar gestanden, eine Stimme: „Geh nach Rom!“ Der Knabe verließ den Gallnerbauern und pilgerte in die ewige Stadt. Ein Mönch sah ihn in einer großen Kirche andächtig beten. Da nahm er den Beter mit sich und führte ihn in ein Haus, in welchem fremde Knaben zu Priestern erzogen wurden.
vorne, wo der Altar gestanden, eine Stimme: „Geh nach Rom!“ Der Knabe verließ den Gallnerbauern und pilgerte in die ewige Stadt. Ein Mönch sah ihn in einer großen Kirche andächtig beten. Da nahm er den Beter mit sich und führte ihn in ein Haus, in welchem fremde Knaben zu Priestern erzogen wurden.
Der Hirtenknabe wurde ein Priester, stieg zum Kardinal empor und mußte zuletzt als Papst Sixtus das Schifflein Petri lenken.
Zur selben Zeit erging von Rom eine Anfrage an den Bischof von Regensburg, wie es mit der Kirche auf dem Gallner stehe. Da wurde diese würdig wieder hergestellt, und als Papst Sixtus nach seinem Tode heiliggesprochen wurde, ward ihm die Gallner Kirche als ihrem Schutzheiligen geweiht. Seine Statue steht auf dem Hochaltar.
Nach Theodor Guggeis
Die Gallnerglocke
Die größere der beiden Gallnerglocken hatte einen wunderbaren Klang. Auch als Wetterglocke stand sie bei den Bauern der  Umgebung in hohem Ansehen, denn wenn sie geläutet wurde, verzogen sich bald alle Gewitter. Davon hörten auch die Böhmen, und so kamen sie in einer dunklen Nacht, um die Glocke zu stehlen. In aller Stille holten sie die Glocke vom Turm und luden sie auf einen Wagen. Schon waren die Glockenräuber unterhalb Forsting, als sie hinter sich das Schreien der Leute hörten, die den Raub bemerkt hatten und nun, mit Sensen, Gabeln und Drischeln bewaffnet, die Böhmen verfolgten. Vor einem Kampf aber fürchteten sich die Böhmen, die Glocke wollten sie aber vernichten, wenn sie dieselbe nicht haben konnten. Deshalb trieben sie einen eisernen Eggzahn durch die Glocke und warfen sie in einen Weiher. Unter Zurücklassung des Wagens und der Ochsen flohen sie dann, als die Verfolger immer näher kamen. Diese aber fanden die Glocke bald und brachten sie wieder auf den Gallner zurück. Seither aber hat die Glocke einen Sprung.
Umgebung in hohem Ansehen, denn wenn sie geläutet wurde, verzogen sich bald alle Gewitter. Davon hörten auch die Böhmen, und so kamen sie in einer dunklen Nacht, um die Glocke zu stehlen. In aller Stille holten sie die Glocke vom Turm und luden sie auf einen Wagen. Schon waren die Glockenräuber unterhalb Forsting, als sie hinter sich das Schreien der Leute hörten, die den Raub bemerkt hatten und nun, mit Sensen, Gabeln und Drischeln bewaffnet, die Böhmen verfolgten. Vor einem Kampf aber fürchteten sich die Böhmen, die Glocke wollten sie aber vernichten, wenn sie dieselbe nicht haben konnten. Deshalb trieben sie einen eisernen Eggzahn durch die Glocke und warfen sie in einen Weiher. Unter Zurücklassung des Wagens und der Ochsen flohen sie dann, als die Verfolger immer näher kamen. Diese aber fanden die Glocke bald und brachten sie wieder auf den Gallner zurück. Seither aber hat die Glocke einen Sprung.
Aus dem Schularchiv der VS Konzell
Die Wetterglocke auf dem Gallner
Vor mehreren hundert Jahren stand auf dem Gipfel des Gallner ein Kirchlein, in dessen Turm eine weit und breit berühmte Wetterglocke hing. Sobald ein Gewitter am Himmel aufstieg, wurde diese Glocke geläutet und das Gewitter verzog sich schleunigst nach Böhmen. Darüber ergrimmten die Bewohner des Wenzelreiches und sie beschlossen, die Glocke zu stehlen. Eines Nachts erschien dann auch ein bewaffneter Troß Böhmen, nahmen die Glocke vom Turme, lud sie auf einen Wagen und zog frohgemut der Heimat zu.
Doch bei Höhenstein, eine Viertelstunde vom Gallner entfernt, gab es plötzlich einen heftigen Donnerschlag und Glocke und Räuber waren im Erdboden verschwunden.
Nach Emmi Böck
Vom wilden Heer – Nachtgejaid
Als der Gallnerbauer einmal nachts nach Hause ging, kam das wilde Nachtgejaid über ihn. Zum Unglück hatte er nichts Geweihtes bei sich; so wurde er vom wilden Heer durch die Lüfte bis nach Ungarn mitgenommen. Beim Gebetläuten wurde er dort niedergelassen. Er machte sich aber sogleich auf den Weg der Heimat zu. Sieben lange Jahre war er unterwegs. Sein Weib hatte inzwischen einen anderen Mann geheiratet. Als er in die Stube trat, erkannte ihn seine Frau nicht mehr. Der Mann bat um eine Schüssel Wasser; durch den langen Marsch hatte er wunde Füße bekommen. Als ihm das Weib die Schüssel reichte, bemerkte sie an seinem Fuß eine Narbe. In Gedanken versunken sagte sie: „Mein erster Mann hatte auch so eine Narbe am Fuß.“- „Ja, schau sie nur besser an!“ sagte der Mann. Und dann erzählte er ihr sein Erlebnis. Als er geendet hatte, fiel er zu Boden und war tot.
Nach einer anderen Version ließ sie sich vom zweiten Mann scheiden und lebte mit ihrem zuerst Angetrauten glücklich weiter.
Von der Volksschule Haibach
Die Mettenschwänzerin
Eine alte Dirn in der Stallwanger Pfarr, die es ohnehin nicht recht mit dem Beten und Kirchengehen hatte und das warme Bett mehr liebte als den beschwerlichen Weg zur Christmette durch kaltes Schneegestöber, spottete einmal: „Gehts ös Heiling nur brav in enka Christmettn, i bleib in mei Bett dahoam und schlaf ma grad gnua!“
Wie gesagt, so getan. Aber siehe, unter der Christmette kam eine unheimliche Weiz in die Schlafstube gehuscht, rüttelte die alte Dirn herb aus ihrem Schlaf und sprach mit schauriger Stimme: „Steh auf, alte Frettn, und geh in d’Mettn!“ Entsetzt fuhr die Dirn unter die Decke und getraute sich den Kopf nicht mehr herauszustrecken. Als die anderen zurückkamen, erzählte sie, in Angstschweiß gebadet, ihr Schreckenserlebnis. Das war von einem guten Jahrzehnt.
Nach Emmi Böck
Die Sage von der Landasberger Riesen
Vor vielen Jahren hausten bei uns Riesen und Zwerge. Sie bauten auf dem Landasberg, Gemeinde Haibach, eine Kirche. Zugleich errichteten sie auch auf dem Gallner ein Gotteshaus. Sie hatten aber nur einen einzigen Steinschlegel. Wenn sie ihn brauchten, warfen sie sich denselben gegenseitig zu. Die Bauleute waren eine Stunde weit voneinander entfernt.
Verfasser unbekannt
Der Tod der Hexe
In Landorf, Gemeinde Stallwang, lebte vor etwa drei Lebensaltern eine alte Austräglerin, die im Geruche einer Hexe stand. Als es bei ihr zum Sterben ging, holte man den Geistlichen, sie aber wies ihn zurück und verschied. In der Nacht beim sog. Leichtwachten, bei dem sich von jedem Haus des Dorfes eine Person zum Beten einfindet, brüllte plötzlich das Vieh im Stalle in schrecklichen Tönen. Als man nachsah, war alles still und ruhig. In der zweiten Nacht hörte man auf einmal im Haus ein furchtbares Gepolter, als würden in der Kammer alle Schuhe und im Keller alle Runkelrüben mit großer Gewalt umhergeworfen. Beim Nachsehen herrsche völlige Ruhe. Nur die Milchbrücke war umgestürzt. Zur Beerdigung wurde die Tote nach Stallwang getragen. Die Truhe war anfangs so schwer, daß man sie kaum heben konnte. Halbwegs bei der sog. Lehmgrube flogen drei Raben daher: und setzten sich auf den Sarg. Als sie wieder wegflogen, fühlten die Träger ihre Last so leicht, als trügen sie die leere Truhe.
Nach Theodor Guggeis
Der Hexentanzplatz
Ein Bauernbursche von Landorf ging einst in der Nacht während der Geisterstunde von einer Tanzmusik nach Hause. Als er bei der Einöde Pielhof zu einer sog. Bilmesbirke, das ist eine Birke mit nach Art der Trauerweiden herabhängenden Ästen, kam, erblickte er plötzlich ein hellerleuchtetes Gasthaus. Eine flotte Tanzmusik scholl ihm aus demselben entgegen. Der Bursche ging hinein und sah einen Saal tanzender Paare, von denen er jedoch niemand erkannte. Er machte einen Tanz mit, aber wie auf einen Zauberschlag war alles verschwunden. Er stand wieder unter der einsamen Birke. Unter jener Birke war der Hexentanzplatz.
Nach Theodor Guggeis
Vom wilden Gejaid
In Emmersdorf bei Stallwang lebte vor langer Zeit ein Bauer namens Engel. Dieser ging in einer finsteren Nacht von Straubing nach Hause. Da hörte er plötzlich das wilde Gejaid über sich in den Lüften. Schnell warf er sich mit dem Gesichte auf den Boden, damit es ihn nicht mitnehmen könnte. Er wurde jedoch erfaßt, in die Lüfte getragen und bis in die ferne Türkei geschleppt, wo er niedergelassen wurde. Fünf Jahre dauerte es, bis der Bauer wieder in seine Heimat kam.
Nach Theodor Guggeis
Der Teufel als Liebhaber
Da unten, in dem Häusel, da ist eine Weibsperson drin gewesen, zu der ist jede Nacht der Kooperator von Konzell zum Kammerfenster gekommen. Da ist sie dann auch einmal in den Pfarrhof gegangen und hat in den Büchern des Kooperators herumgekramt. Der Kooperator hat sich gewundert und sie gefragt: „Was tust denn da?“ Sie antwortete: „Hast es mir doch erlaubt, daß ich einmal zu dir kommen darf!“ – In der Zeit ist wieder einmal Gesellschaftstag gewesen, und die geistlichen Herren von Rattenberg, Altrandsberg und Konzell sind im Gasthaus in der Wies zusammengekommen. Bei der Gelegenheit hat der Kooperator die seltsame Geschichte erzählt. Da sagte der Pfarrer Lechner – der ist von 1825 bis 1850 da gewesen -: „Den kriegen wir schon!“ So sind sie alle miteinander in die Kapelle dort hinauf, haben die Weibsperson auch dazu geholt und haben gebetet. Da ist er gekommen und hat gesagt: „So komm ich!“ Da hat der Pfarrer Lechner gesagt: „So mußt kommen, wie du zu der Resl gekommen bist!“ Und wieder ist er gekommen und hat gesagt: „So komm ich!“ Und wieder hat der Pfarrer Lechner gesagt: „So mußt du kommen, wie du zu der Resl kommen bist!“ Da ist er auf einem Schimmel geritten gekommen, und wenn sie den Kooperator nicht zwischen sich gehabt hätten, hätten sie gemeint, er ist es. Jetzt hat der Pfarrer Lechner gegen ihn zu beten begonnen. Da sagt der Teufel:“ Du hast keine Macht über mich, hast auch schon einen Sechser gestohlen!“ – Ja, aber zu einem guten Zweck angewendet. Hab studiert davon, hab mir Stahlfedern gekauft!“ Etwas anderes konnte ihm der Teufel nicht vorwerfen und ist davon. Und so gestunken solls da haben.
Nach Emmi Böck
Die Schneiderin von Kasparzell
In Kasparzell bei Konzell lebte vorzeiten eine alte Schneiderswitwe, die allen Leuten möglichst aus dem Weg ging, der aber auch niemand zulief. Denn sie galt als Hexe und war gefürchtet.
Wenn in der Pfarrei Konzell irgendwem ein Unglück zustieß, so wußte man immer gleich den Grund:“ Die alt Schneiderin hat’s eahm odo!“ Für niemand sandte man die siebte Bitte des Vaterunsers: “ Erlöse uns von dem Übel!“ inniger zum Himmel als für sie. Endlich wurde sie bettlägerig, und einige Wochen darauf machte sie die Augen für immer zu. Alle Leute der Umgegend atmeten wie von einem Alp befreit auf, und in voller Aufrichtigkeit betete man: „Herr, gib ihr die ewige Ruhe!“
Als man sie zu Grabe trug, flatterten plötzlich Raben her und setzten sich auf den Sarg. Der Mesner verscheuchte sie, worauf sie krächzend abzogen. Darauf spürten die Träger, daß der Sarg mit einem Male leichter geworden war. Die Leute erzählten, daß der Teufel nun auch ihren Leib geholt habe.
Nach Emmi Böck
Die zwei Schreinerbuben
Vor langer Zeit lebten in Loitzendorf zwei Schreinersbuben, denen ihre Schwester den Haushalt führte. Das Schreinerhandwerk machte ihnen keine besondere Freude. Da fiel ihnen ein sog. Schwarzbuch in die Hände, welches allerlei Anweisungen für Hexenmeister enthielt. Einer der beiden machte sich einen kleinen Schemel aus neunerlei Holz. Diesen nahm er in der Christnacht mit in die Kirche und kniete sich darauf. Er konnte nun alle Hexen sehen, welche in der Kirche waren, weil jede bei der Wandlung das Gesicht rückwärts drehte. Es waren derer eine große Zahl, aber er mußte schleunigst davon, da die Hexen zurückrasten und ihn mit Steinen bewarfen. Der Hagel hörte erst auf, als er mit seinem Schemel das Schreinerhaus erreicht hatte.
Nah Theodor Guggeis
Das Spukweiblein
Vor etwa eineinhalb Jahrhunderten kam nachts nach dem Gebetläuten zu der Füchslbäuerin in Ichendorf, Gemeinde Konzell, ein kleines, ganz zusammengeschrumpftes Weiblein. Leise wimmernd blieb es vor einem Fenster stehen und blickte mit geisterhaften Augen in die Stube. Da das Weiblein öfter kam, fragte die Bäuerin nach seinem Begehren. Es erzählte weinend, daß im Kellerholz an der Straße nach Konzell an einer bestimmten Stelle eine Schüssel voll Geld vergraben sei und daß die Bäuerin die Gnade habe, dieses Geld heben zu können. Sie brauche bloß an Maria Himmelfahrt in der Nacht an die Stelle zu gehen, einen Kreis zu ziehen, und das Geld werde zum Vorschein kommen. Die Bäuerin getraute sich jedoch nicht hin. Da kam das spukhafte Weiblein wieder und klagte schluchzend, daß jetzt noch so lange leiden müßte, bis auf der Stelle, wo das Geld liege, ein Baum wachse: Aus dem Baum müßten Bretter geschnitten und aus den Brettern eine Wiege gemacht werden. Und erst wieder eine Frau, die aus dieser Wiege stamme, sei imstande, es zu erlösen. Dann ging das Weiblein fort und kam nicht mehr an das Fenster.
Die mühsame Ersparnis
Ein altes Weiblein lebte recht genügsam und einfach und sparte seine geringen Einnahmen recht Mühsam zusammen. Es hatte nun schon einige hundert Mark gespart. Da bat es ihr Nachbar, ihm das Geld für kurze Zeit zu leihen. Nach wenigen.. Wochen zählte er ihm das Geld bis auf den letzten Pfennig auf den Tisch. Dies sah der Knecht, und es erwachte in ihm eine wilde Gier nach dem Geld. Er faßte einen bösen Plan. Als am nächsten Sonntag seine Herrin in der Kirche war, raubte er ihr das ganze Geld. Mit großer Bestürzung bemerkte das die alte Frau, als sie heimkam. Was sollte sie nun tun? Da ging sie zur Ziermühle und klagte dort ihr Leid. Der Ziermüller hatte ein Schwarzbuch. Das holte er nun hervor und begann darin zu lesen. Nach einer Weile sagte er: „Das Geld bekommst du wieder; es ist im Heustock, unter dem ersten Balken versteckt.“
Sie gingen nun beide zum Knecht und er gestand ihnen, das Geld versteckt zu haben. So erhielt das Weiblein wieder sein Geld.
Aus der Flursammlung von Prünstfehlburg
In und um Wiesenfelden
Nachfolgende Sammlung stammt aus der Feder des ehemaligen Lehrers von Wiesenfelden, Wilhelm Duschl, erschienen in Heft Der Bayerwald im Jahre 1927.
Die Glocke auf St. Rupert
Im Turne der ehemaligen Pfarrkirche von Wiesenfelden, dem hl.  Rupert geweiht, hängt eine hochgeweihte, wunderbare Glocke. Wenn ein Gewitter aufzog, läuteten die Leute in ihrer Angst und Sorge diese Glocke. Jedesmal verzog sich das Unwetter, um sich im Böhmerwald zu entladen. Das wurde nun den Böhmen doch zu arg. Sie schickten aus, diese für sie so gefährliche Glocke zu holen und wenn, auch mit Gewalt. Aber die Wiesenfeldener rochen Lunte und verschanzten sich hinter der dicken, hohen Mauer, welche die Kirche einst umfriedete. Die Böhmen versuchten die Herausgabe der Glocke zuerst auf gütlichem Wege zu erreichen. Wie aber das nicht fruchtete, stürmten sie unter Zeter und Mordio an. Aber nur blutige Köpfe führten die Böhmen heim und heute noch hängt die Glocke im Turme.
Rupert geweiht, hängt eine hochgeweihte, wunderbare Glocke. Wenn ein Gewitter aufzog, läuteten die Leute in ihrer Angst und Sorge diese Glocke. Jedesmal verzog sich das Unwetter, um sich im Böhmerwald zu entladen. Das wurde nun den Böhmen doch zu arg. Sie schickten aus, diese für sie so gefährliche Glocke zu holen und wenn, auch mit Gewalt. Aber die Wiesenfeldener rochen Lunte und verschanzten sich hinter der dicken, hohen Mauer, welche die Kirche einst umfriedete. Die Böhmen versuchten die Herausgabe der Glocke zuerst auf gütlichem Wege zu erreichen. Wie aber das nicht fruchtete, stürmten sie unter Zeter und Mordio an. Aber nur blutige Köpfe führten die Böhmen heim und heute noch hängt die Glocke im Turme.
Der glühende Wiesbaum
Eine Frauensperson aus Geraszell verdingte sich zu einem Bauern in Englbarzell. Bei Eintritt der Dämmerung sieht sie eine glühende Stange in der Luft. Die Stange stieg auf dem Büscherl auf, zog durch die Luft und verschwand im Kamin eines Hauses in Wiesenfelden.
Es wurde schon beobachtet, wie der glühende Baum von Ebersroith nach Höhenberg zog.
Von Wilhelm Duschl
Der schwarze Hund
In Mitternachtsstunde treibt hier ein schwarzer Hund sein Unwesen. Mehreren Leuten, die in dieser Stunde auf dem Wege waren, ist er schon begegnet.
Der Geist auf der Friedhofsmauer
Vor vielen Jahrzehnten wurde hier ein Selbstmörder kirchlich beerdigt. Aber nie hatte es mit dem Grabe eine Richtigkeit. Entweder stand der Grabstein verkehrt, oder die Grabumfassung lag abseits. Fast jeden Morgen konnte man eine Veränderung wahrnehmen. – Einmal am frühesten Morgen, als die Schloß-Mahder zum Mähen gingen, sahen sie auf der Friedhofsmauer eine Gestalt sitzen, die dem Selbstmörder sehr ähnlich war. Erschrocken weckten sie den Pfarrer auf und machten Meldung. Wie der Geistliche kam, war die Gestalt verschwunden. Man glaubte schließlich der Erzählung der Schloßtaglöhner nicht. Wirklich war auch längere Zeit Ruhe. Wieder einmal sehen in aller Frühe, so um drei Uhr, andere Arbeiter des Schlosses die Gestalt in ganz gleicher Stellung. Wieder machten sie dem Pfarrer Meldung. Es wurde nun veranlaßt, daß der Leichnam aus der geweihten Erde kam. Er wurde ohne Segen an der Friedhofsmauer eingescharrt, dort, wo er sich immer zeigte. Nun war Ruhe.
Von Wilhelm Duschl
Am Pflügl-Weiher
Auf dem Wege von Heilbrunn nach Hötzelsdorf liegt der Pflüglweiher. Rundum standen früher recht hohe Gebüsche. Diese gaben dem Platze ein geisterhaftes Aussehen. Der Weiher war der Badeplatz der Umgebung. Gegen Abend ging ein Mann vom Heilbrunner Wirtshaus nach Hause. Sein Weg führte ihn am Weiher vorbei. Da kam er auf den Gedanken, wenn jemand badet, den recht zu erschrecken. Er schnitt sich eine Gerte ab und versteckte sich im Erlengebüsch. Wirklich sah er bald einen weißen Rücken heranschwimmen. Er schlug mit der Gerte darauf ein. Im selben Augenblick verschwand der Rücken, ein Pferd sprang aus den Stauden und legte den Kopf schwer auf die Schulter des Mannes. Er wollte enteilen. Aber das Pferd hielt fest. Langsam und zitternd kam er nach Hause.
Von Wilhelm Duschl
Fleisch-Hirn-Anger
In Hötzelsdorf zieht sich längs der Straße ein Wiesenabhang hin mit obigem Namen. In der Nähe steht ein Haus. Der Mann des Hauses ging spät nachts heim. In der Nähe des Angers hörte er das Treiben der wilden Jagd. Er hetzte seinen Hund hin und sagte: „huß! huß! – und mei Wackerl a dabei“ Es trat sofort Ruhe ein. Aber der Hund kam nicht mehr zurück. Der Mann ging heim. Als er die Haustüre aufsperrte, sprang gleich die Stubentüre aufs und es wurde der Knochen eines menschlichen Oberschenkels hingeworfen mit den Worten: „So, das ist der Fuß, daß der Wackerl auch dabei gewesen ist!“
Hochholz
Zwischen Geraszell und Heilbrunn liegt ein Wäldchen mit obigem Namen. Das Wirtshaus in Heilbrunn war früher da, wo jetzt der Krämer ist. Der Wirt ging nun einmal von Geraszell heim. Lustig wie der Wirt war, sang er sich ein Liedchen vor. Auf einmal singt drüben im Hochholz auch jemand. Der Heilbrunner ruft:“Geh, geh a weng uma und hilf mir!“ Kaum hatte ers ausgesprochen, stand auch schon eine Gestalt neben ihm. Der Wirt erschrak ordentlich und lief heim. Die Gestalt lief aber mit. Beim Feuerhaus nun, wo der Weg nach Großficht abzweigt, verschwand die Gestalt spurlos.-
Ein Bursche ging einmal nachts von Heilbrunn nach Geraszell. Er rauchte eine Zigarre. Es wurde ihm schon oft erzählt, daß es im Hochholz Geister geben soll. Aber er glaubte nicht daran. Da erlöschte ihm die Zigarre. In seinem Übermute schrie er ins Hochholz: „Geht do oana runta und zend ma mei Zigarrl an!“ Er hatte noch nicht ausgesprochen, standen auch schon drei Gestalten neben ihm. Der Bursche wußte nun nicht in seiner großen Angst, was jetzt anfangen. Schließlich fing er laut zu beten an. Da ging die mittlere Gestalt auf ihn zu, berührte ihn und sagte: „Das hat dir dein Herrgott in den Sinn geb’n, sonst hätt’n wir dir deine Zigarre richtig angezündet!“ Worauf die drei verschwanden.
Von Wilhelm Duschl
Schlangen als arme Seelen
Im Volksmunde leben auf bewaldeten Höhen Schlangen, „arme 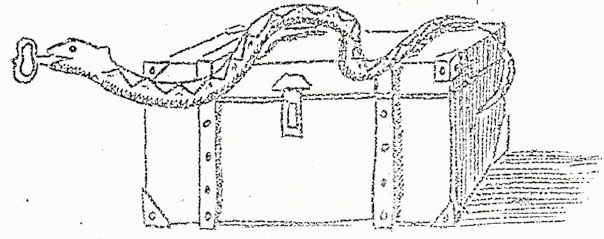 Seelen“, die auf Erlösung warten. Sie liegen auf eisernen Truhen, in denen ein großer Schatz liegt. Den Schlüssel zur Truhe haben die Schlangen im Maule. Wenn man sich zur Mitternachtsstunde hinwagt und den Schlüssel nimmt, hat man eine arme Seele erlöst und bekommt dafür den Goldschatz. Es wird erzählt, daß in hiesiger Gegend eine Hütbube eine arme Seele erlöste und dann ein reicher Mann wurde.
Seelen“, die auf Erlösung warten. Sie liegen auf eisernen Truhen, in denen ein großer Schatz liegt. Den Schlüssel zur Truhe haben die Schlangen im Maule. Wenn man sich zur Mitternachtsstunde hinwagt und den Schlüssel nimmt, hat man eine arme Seele erlöst und bekommt dafür den Goldschatz. Es wird erzählt, daß in hiesiger Gegend eine Hütbube eine arme Seele erlöste und dann ein reicher Mann wurde.
Von Wilhelm Duschl
Die „feurigen Männer“
Im Volksmunde geht die Märe, daß arme Seelen, die der Erlösung harren, als „feurige Männer“ herumwandeln zum Nutzen der Menschheit. In der Nähe von Hötzelsdorf arbeiteten die Leute in fortgeschrittener Abendstunde noch auf dem Haferfelde. Sie sahen fast nichts mehr. Da kamen drei „Feurige Männer“ daher. Ein Arbeiter rief ihnen zu: „Geh doch einer her und leuchte uns.“ Einer von den dreien kam sofort und stellte Leuchte. Die Leute arbeiteten fertig und gingen dann heim. Auch der „Feurige“ ging mit. Man wußte nun nicht mehr, wie man ihn los bringe. Endlich sagte der Bauer: „Nun dank dir’s Gott.“ Da gab der „Feurige“ zur Antwort: „Ein Dank dir, Gott ist mir noch abgegangen, nun bin ich erlöst.“ Er verschwand.
Ein Dienstknecht von Haunsbach mußte eine Fuhr Hafer nach Roding führen. Auf dem Rückwege wurde es ihm finster und er wünschte: wenn nur ein „Feuriger“ kommen würde! Sofort war der Wunsch erfüllt. Ein „Feuriger“ leuchtete ihm heim. Auf ein „Nun dank dir Gott“ verschwand auch dieser und ward erlöst.
Von Wilhelm Duschl
Wie der Wallfahrtsort Heilbrunn entstand
Als vor 350 Jahren die Schweden in unserem Lande hausten, haben die Leute überall die Heiligenbilder versteckt und vergraben, um diese vor Schändung zu bewahren. Auch in Heilbrunn geschah es so, und da viele Leute an der Pest gestorben sind, wußte bald niemand mehr, wo diese Bilder versteckt waren.
Auf wunderbare Weise sollte bald eine vergrabene Statue der Gottesmutter wieder gefunden werden. Da lebte in dem Ort Viecht  bei Wiesenfelden ein Maurer namens Adam Kurz. Er war an der Gicht erkrankt, und niemand konnte ihm helfen. Da hatte der Kranke einen seltsamen Traum. Es erschien ihm der Herr und gab ihm den Auftrag, in Brünnl, etwa zehn Meter vom Bächlein entfernt, in der moosigen Wiese nachgraben zu lassen; man werde ein Muttergottesbild finden. An der gleichen Stelle werde eine Quelle hervorspringen, dessen Wasser ihn gesund machen werde.
bei Wiesenfelden ein Maurer namens Adam Kurz. Er war an der Gicht erkrankt, und niemand konnte ihm helfen. Da hatte der Kranke einen seltsamen Traum. Es erschien ihm der Herr und gab ihm den Auftrag, in Brünnl, etwa zehn Meter vom Bächlein entfernt, in der moosigen Wiese nachgraben zu lassen; man werde ein Muttergottesbild finden. An der gleichen Stelle werde eine Quelle hervorspringen, dessen Wasser ihn gesund machen werde.
Man grub, wie der Traum befahl, an der bezeichneten Stelle und fand die Statue und die Quelle. Der Kranke wurde an die wunderbare Quelle getragen und mit dem Wasser gewaschen. Sogleich wich die Krankheit von ihm. Seine Krücken hängte er an einen nahen Erlenbaum.
Das Bild der Gottesmutter wurde in eine Kapelle zur Verehrung aufgestellt. Um den Brunnen herum aber entstanden Kirche und Schule und einige Häuser, die den Namen Heilbrunn erhielten. Im Volksmund heißt der Ort noch heute einfach Brünnl.
Nach einem Zeitungsbericht
Drude und Brettlsteiger
Wenn der Geistliche bei Taufzeremonien eines weiblichen Wesens ein Wort ausläßt oder falsch spricht, ist es verdammt, zeitlebens eine Drude zu machen. Wird nun bei der Taufe eines männlichen Wesens etwas übersehen durch den Pfarrer, so wird es ein Brettlsteiger.
Die Drude kommt bei Nacht zu Menschen und drückt sie ganz verdammt her. Es ist hier Sitte, daß die Mädchen jeden Abend in einem anderen Haus zum Spinnen zusammenkommen. Die Höhenberger Mädchen gingen auch einmal abends heim. Ein Mädchen blieb zurück und kam lange nicht mehr nach. Die anderen gingen weiter und kamen zu einem Haus. Sie hörten aus dem Haus Ächzen und Stöhnen. Wie sie näher hinschauten, lehnte der Körper des Mädchens, welches zurückblieb, wie tot an der Haustüre. Der Geist marterte oben den Knecht her. Sie wußten nun, das eine Drud ihr Unwesen trieb. Den Körper durften sie nicht anschreien, sonst wäre er wirklich gestorben.
Der Brettlsteiger dürfte verwandtes haben mit einem Mondsichtigen. Er muß während der Nacht aufstehen und stundenlang auf dem Boden, also auf Brettl’n, umherwandern. Ein Bauer aus hiesiger Umgebung hatte einen Knecht. Es kam oft vor, wenn der Bauer in der Frühe rief, daß der Knecht keine Antwort gab und verspätet und müde zur Arbeit kam. Zur Rede gestellt, antwortete er: „O, mei Bauer, i woaß ja nöt, wo i bi, wenn du schreist. I bi ja gar nöt da!“
Von Wilhelm Duschl
’s Loseln
In der Losnacht (Christnacht) soll man sehen, wer im nächsten Jahr stirbt. Man muß an einer Kreuzstraße einen Kreis ziehn, in den man sich stellt und die Mitternachtsstunde abwarten. Manchmal soll man eine schwere Furchtprobe zu bestehen haben. Wenn man aus dem Kreis heraustritt, die Probe nicht besteht, ist man verloren.
Auf der Kreuzstraße in Gscheibtebuche loselte einer. Während der Furchtprobe kamen unendliche Fuhren Heu, Stroh, Holz, Mist und fielen auf ihn ein. Er fürchtete sich aber nicht und konnte alle diejenigen sehen, die im nächsten Jahre sterben müssen.
Um das auch sehen zu können, loselte ein Bauer im Stall unter einem Kreuzbalken. Als die Mitternachtsstunde schlug, war ihm, als stürze der Stall auf ihn ein. Aber tapfer hielt er aus und hörte nun zwei Ochsen mitsammen reden: „Alle mitsammen müssen wir zur Kirche fahren!“ Der Bauer wußte nun, daß im kommenden Jahr der Bauernhof ausstirbt und die Ochsen alle Bewohner zum Friedhof fahren müssen. Dem wollte er vorbeugen. Er verkaufte die Ochsen weit fort. Nach kurzer Zeit kaufte aber der Nachbar die Ochsen zurück. Und siehe! Im Hofe begann ein großes Sterben. Der Hof starb aus bis auf die 12-jährige Tochter. Eine alte Frau trieb das Mädchen zur Heirat, daß neues Blut in den Hof käme. Das Sterben hörte auf.
Von Wilhelm Duschl
Vom „umgehen“
In Ederöd ist’s nicht geheuer, nöt sauba, sagt das Volk. Die Mutter des Hauses schöpft Wasser. Da hört sie hinter dem Hause, im Walde, ein erbärmliches Kindergeschrei. Sie ruft den Vater und beide gehen dem Geschrei nach. Immer nahe hören sie das Geschrei, aber sie kommen nicht hin. So werden beide bis gegen Höhenberg geführt. Da sagt die Alte: „Geh, Alter kehr’n ma um, dös is nix g’scheits!“ Am andern Tag wollte die Frau im Nebengebäude das Korn umschaufeln. Wie sie hinkam, hörte sie schon jemanden kehren und schaufeln. In ihrer Angst lief sie zum Manne. Der ging nun hinein und kam bald wieder heraus, ganz blau im Gesicht. Er wurde ganz fürchterlich gedrosselt. – Eine Frauensperson, d’Mauerer Wabn, zog mit ihrem unehelichen Kind in dieses Nebenhaus. Die fürchtete nichts. Während sie ihr Kind wiegte, wurden die Türen gar heftig auf- und zugeschlagen.
Von Wilhelm Duschl
Raum um Ascha und Falkenfels
Das erfüllte Gelöbnis
Wer auf der Straße von Ascha nach Falkenfels geht, sieht auf der Höhe rechterseits zwei Gehöfte. Das untere Anwesen wurde vor mehr als hundert Jahren von dem Bauern Sepp Woferl bewirtschaftet. Dieser fuhr einmal mit einem schwer beladenen Wagen auf der ziemlich steil abfallenden Straße nach Ascha. Als er die Bremse am Wagen anziehen wollte, geriet sein langer Rockzipfel unter das linke Vorderrad; Sepp Woferl fiel zu Boden und war in Gefahr, vom Rad erdrückt zu werden. In dieser Todesnot rief er die Hilfe der Muttergottes an und versprach, eine Statue der Muttergottes in der Kirche zu Ascha aufzustellen, wenn er unverletzt aus seiner Lage befreit werde.
Der Bauer erlitt keinen Schaden und hielte sein Versprechen. Er stiftete eine Statue der Gottesmutter mit dem Jesuskind am Arm. Lange Jahre befand sich diese Figur in einer Nische an der Südseite der Kirchenmauer über dem Haupteingang. Da die Statue durch Witterungseinflüsse stark gelitten hatte, wurde sie vor vielen Jahren erneuert. In farbenfroher Schönheit steht sie heute noch auf dem linken Seitenaltar der Kirche zu Ascha.
Nach Lina Hollmer
Die Roßreibn
Auf der Strecke von Ascha nach Pilgramsberg macht die Straße oberhalb Höfling eine starke Kurve, im Volksmund Roßreibn genannt. Es geht die Sage, daß dort abends nach dem Gebetläuten ein Schimmel ohne Kopf die Kurve auf- und abgehe. Ein roher Fuhrmann soll an dieser Stelle seinem Zorn freien Lauf gelassen und einem Schimmel den Kopf abgehauen haben, als dieser den schwer beladenen Wagen bergauf nicht mehr ziehen konnte.
Nach Lina Hollmer.
Wallfahrt Pilgramsberg
Das Dorf Pilgramsberg ist 1150 erstmals urkundlich erwähnt. Schon 1370 wurde in Pilgramsberg der sogenannte Bergmarkt, heute eine Art Volksfest, abgehalten. Die Wallfahrtskirche St. Ursula war bis in die jüngste Zeit ein beliebter Wallfahrtsort. Noch heute finden immer wieder Wallfahrten hierher statt. Der heutige Kirchenbau entstand gegen Ende des 17. Jahrhunderts.
Zunächst bestand eine Wallfahrt zur heiligen Ursula, der die Kirche geweiht ist. Die Marienwallfahrt auf diesen Berg ist jüngeren Datums.
 Zur Entstehung der Marienwallfahrt gibt es zwei Legenden:
Zur Entstehung der Marienwallfahrt gibt es zwei Legenden:
1. Ein Holzknecht fand das Bildwerk in einer Buche und stellte es bei einer Bäuerin in den Herrgottswinkel. Als nach dem Tod der Frau der Hausrat unter die Erben verteilt wurde, soll es ein Mann um drei Kronentaler erworben und auf den Pilgramsberg gebracht haben.
2. Die zweite Legende berichtet, daß das Marienbild durch einen Dienstknecht namens Georg Fenzl aus Haindlingberg hierher gekommen sei. Ursprünglich soll es 1443 in einem hohlen Baum bei Ingolstadt aufgestellt gewesen sein. In den Religionswirren wurde es in Sicherheit gebracht. So blieb es bis zum Jahr 1680 in Privatbesitz. Warum und auf welche Weise es nach Regensburg gelangte, ist nicht überliefert. Dort soll es jener Fenzl bekommen haben.
Aus einem Zeitungsbericht
Wie der Sepperl sehend ward
In dem Dörflein Kiefernholz bei Wörth erkrankte im Jahre 1842 der erst zweijährige Sepperl und wurde schließlich blind. Große Trauer und übergroßer Schmerz befiel seine liebende Mutter.
Da hörte die betrübte Frau von der Wallfahrt auf den Pilgramsberg. So beschloß sie, eine Wallfahrt dorthin zu machen und um Gnade für ihr krankes Kind zu bitten. Unter frommen Gebeten brachte sie ihren Sohn in die Wallfahrtskirche und betete so innig, wie nur eine liebende Mutter beten kann. Der liebe Gott hatte ihr Flehen erhört und den Jungen wieder sehend gemacht.
Sie selbst aber pilgerte Jahr für Jahr zu Muttergottes nach Pilgramsberg und dankte dort für die Heilung ihres Kindes.
Aus „Die Wallfahrt Unserer Lieben Frau vom Pilgramsberg“
Die Sage vom Falkenfels
Als der herzogliche Vetter von Böhmen zu Besuch in Weißenstein beim Grafen Hund war, ritten sie zusammen nach Steinach zum Bruder des Grafen Hund zu einer gemeinsamen Falkenjagd. Da dort tief in einem Walde ein Felsen mit vielen Falkenhorsten zu finden war, machten sie diesen zu ihrem Jagdziel. Als der Herzog den Falkenfelsen sah, unten am Fuße den See und das offene Land, rief er aus: „Dieser Ort hier ist so schön wie meine Heimat, lasset uns hier ein Jagdschloß erbauen! Ich habe Bauleute genug und schicke euch einige Hundert!“ — Und so geschah es. Als dann die böhmischen Bauleute das viele unbebaute Land sahen, gefiel es auch ihnen hier, und sie erbauten ihre Hütten, um für immer zu bleiben. Dann erbauten sie, wie ihnen befohlen, das Jagdschloß Falkenfels. Mit der Zeit wurde aus dem Jagdschloß eine feste unbezwingbare Burg. So erzählt die Sage.
Verfasser unbekannt
St. Johann bei der alten Eiche
Ein schöner Waldweg führt hinter Steinach nach Falkenfels hinauf und dort oben auf der Höhe steht das Johannikircherl, dessen Kuppeltürmlein bis nach Straubing hinaus zu sehen ist. Ein wahrhaft gottseliger Platz ist dort oben: Tannen und Buchen umstellen das Kircherl und schließen mit ihm einen Wiesenfleck ein, der mit ein paar Obstbäumen bestanden ist, unter denen sich ein altes Bauernhaus versteckt.
Ein paar Alte erzählen von der uralten mächtigen Eiche, die hier vor  dem Kircherl gestanden ist und von dem der Ort St. Johann bei der alten Eiche genannt wird. Ein riesiger Baum muß es gewesen sein, sechs Männer konnten mit ausgebreiteten Armen den dicken Stamm kaum umspannen.
dem Kircherl gestanden ist und von dem der Ort St. Johann bei der alten Eiche genannt wird. Ein riesiger Baum muß es gewesen sein, sechs Männer konnten mit ausgebreiteten Armen den dicken Stamm kaum umspannen.
Vor langer Zeit ist der riesige Baum, der längst ausgehöhlt war, zusammengebrochen, wie mancher Greis eines Tages einfach zusammensinkt.
An der alten Eiche war ein Bildstock, und wahrscheinlich war dieser Baum überhaupt der ursprüngliche heilige Ort, zu dem man einst wallfahrten gegangen ist. In der alten Zeit, als die Kirchen noch nicht überall gebaut waren, suchte sich das Volk für seine Andacht gern solche Orte, wo Bäume standen und ein Brunnen floß.
Nach O. Döring
Die Sage von St. Johann
Als die Schweden im Bayerland waren, nahmen sie von allen Kirchen die Glocken, um in Passau daraus Kanonen gießen zu lassen. So haben sie auch die Glocke von dem Kirchlein auf dem Gallnerberg heruntergenommen und fuhren mit ihr über Falkenfels und St. Johann. Da die Fuhre mit den gestohlenen Glocken zu schwer war, warfen sie bei St. Johann eine Glocke vom Wagen, und zwar die vom Gallnerberg. Diese wurde viele Jahre später gefunden und in dem Kirchlein aufgehängt. Sie soll heute noch im Turm zu St. Johann hängen und zur Ehre Gottes läuten. So erzählt die Sage.
Verfasser unbekannt
Wie der Räuber Matzeder eine Steinacher Bäuerin federte
Der Räuber Franz Matzeder aus Matzöd, Landgericht Landau, wurde am 23. Juni 1851 in Straubing hingerichtet. Als Matzeder auf dem Schinderkarren gebunden und gefolgt von vielem Volk zur Richtstätte gefahren wurde, brach er plötzlich zur Verwunderung aller in unbändige Heiterkeit aus. Vom Henker befragt, wie er angesichts des Todes noch so herzhaft lachen könne, erzählte der Delinquent sein schandbares Schelmenstück, wie er einmal bei Steinach eine Bäuerin gefedert hatte.
Er drang an einem Sonntagmorgen in einen Bauernhof bei Steinach ein, dessen Bewohner alle zum Gottesdienst gegangen waren mit Ausnahme der Bäuerin, die sich in gesegneten Umständen befand. Wie erschrak sie, als sie in dem frechen Eindringling den berüchtigten Räuber erkannte! Weinend bat sie um Erbarmen. Matzeder beschwichtigte sie — sie brauche nichts zu befürchten, wenn sie tue, was er sie heiße. Erleichtert ging die Bäuerin darauf ein, worauf er ihr befahl, sich zu entkleiden und ihre langen Haare zu lösen und wallen zu lassen. Widerstrebend gehorchte sie; hierauf ließ er sich von ihr einen Kübel Honig geben, schüttete diesen der gepeinigten Frau über den Kopf, schnitt ein Federbett auf und zwang die Bäuerin, sich darin zu wälzen.
Daraufhin mußte sie in dieser unfreiwilligen Verkleidung ihrem aus der Kirche heimkehrenden Mann entgegengehen. Matzeder ging mit geladenem Gewehr hinter ihr her, damit sie den Befehl getreulich vollziehe. Als die Arme ihren Ehemann mit anderen Bauern aus dem Wald herankommen sah, lief sie ihm laut jammernd entgegen. Bei diesem ungewohnten Anblick ergriffen die abergläubischen Landleute die Flucht im Glauben, der leibhaftige Teufel jage hinter ihnen her.
(Entnommen aus „Straubinger Hefte“, Nr. 35 (1985) mit dem Titel „Historisches Mosaik aus Niederbayern“, von Hans Schlappinger (1882-1951). Herausgegeben vom Johannes-Turmair-Gymnasium.)
Die Zigeunerbaronin von Münster
An einem grauen Novembertag des Jahres 1858 kam eine hochschwangere unbekannte Bettlerin mit zigeunerhaftem Aussehen von Falkenfels nach Münster und bettelte von Haus zu Haus. Am Ortsende, beim Bauern Johann Geier, erhielt sie im warmen Kuhstall ein Nachtquartier. In der Nacht gebar sie ein Mädchen, die Mutter aber starb. Es konnte nicht festgestellt werden, woher sie war und wie sie hieß. Die kinderlosen Eheleute Trimpl, die am Hatzenberg ein kleines Häuschen bewohnten, nahmen das Kind an und gaben ihm den Namen Luise. Nachdem Luise neun Jahre alt geworden war, kam sie zum Bauern Fischer; denn ihre Adoptiveltern waren kurz hintereinander gestorben. Das Mädchen entwickelte sich bald zu einer kleinen Schönheit. Es hatte tiefschwarze Haare und ausdrucksvolle Gesichtszüge. Ihren Altersgenossinnen war es körperlich und geistig weit voraus.
Eines Tages, im Oktober 1872, kehrte Luise vom Viehhüten nicht mehr zurück. Durchziehende Zigeuner hatten sie als eine der ihren erkannt und mitgenommen. Die Gemeinde erfuhr erst wieder etwas von ihr, als 1879 eine Klinik in Frankfurt/Main eine Kostenrechnung schickte, die die Armenkasse der Heimatgemeinde begleichen mußte. In den nächsten fünf Jahren kamen noch mehrere solcher Rechnungen. Dann wurde es still um sie.
Eines Tages aber, im Sommer 1903, fuhr im Münsterer Schulhof eine Kutsche vor, aus der eine elegante Dame stieg, die sich als Baronin von Bertling aus Batavia, frühere Luise Trimpl aus Münster, vorstellte. Sie erzählte, daß sie in einem Freudenhaus in Bremerhaven gelandet sei. Sie habe dort einen reichen Plantagenbesitzer aus Batavia/Indonesien kennengelernt, der sie geheiratet und nach Java mitgenommen habe. Ihr Mann sei vor zwei Jahren verstorben und habe ihr ein großes Vermögen hinterlassen. Zwei Monate blieb sie in Münster. Auf ihre Veranlassung wurden die Gebeine ihrer Adoptiveltern exhumiert und mit großem kirchlichen Aufgebot neu bestattet; sie ließ ihnen auch ein schönes Grabmal setzen. Die armen, kinderreichen Familien der Gemeinde besuchte und beschenkte sie. In den Wirtshäusern Solleder und Roßmüller bewirtete sie alle Dorfbewohner. Dann reiste sie ab und niemand hat je etwas mehr von ihr gehört.
Von Ludwig Muhr
Der Michl tut Beicht hören
Die feurige Schultatzn aus der guten alten Zeit traf meist keinen Unschuldigen und sühnte oft irgendeine Untat. Der Bauernmichl aus Rotham bei Steinach frevelte einmal mit dem Beichtstuhl. Der Schelm setzte sich in den Beichtstuhl des Pfarrers und spielte den Beichtvater. Sein Freund beichtete ihm seine bekannten und unbekannten Greueltaten. Da gibt’s Geräusch und Geflüster; sie sind von neugierigen Mädchen entdeckt, kommen an die große Glocke und haben nun die Aussicht am anderen Tag mit dem spanischen Rohr gottsjämmerlich abgeledert zu werden. So kam’s auch, und da hatte sich der Michel mit großer List vorgesehen. Der Michel bot seinen edelsten Körperteil in die Marter und schmunzelte sogar eine gute Weile. Er hatte nämlich mit Rat und Mithilfe seines Schulfreunds sein gefährdetes Hinterteil mit dem Fürfleck (Schürze der Handwerker) seines Vaters bestens gepanzert. Aber selbst als man Verdacht schöpfte, ihm den Fürfleck aus der Ledernen zog und ihm nun doppelt gepfeffert aufmaß, blieb der Michel aus verbissenem Bubenstolz unzerknirscht, schmerzfest und klaglos. Was in der Schule geschehen war, bekam der Vater natürlich auch zu hören und er nahm sich den Michel auch noch vor. „Michel“, sprach er gesetzt und mit grimmigem Schmunzeln, „i hab ja g`hört, du bist gar beichtg`sess’n im Pfarra sein Beichtstuhl?“ Der Michel stand wie ein Gänserich auf dem linken Bein und schwieg trotzig. „Schau, Michel“, fuhr der Vater noch beißender fort, „da ist dir ja da Chorrock z`lang gwen!“ Der Michel lümmelte sich voll finsteren Verdrusses mit dem Ellenbogen in den Tisch und starrte zum Fenster hinaus. „Wie Michel“, stichelte und stachelte der Vater, „geh her zu mir und laß dir an Beichtchorrock a wengal abschneidn!“ Dabei langte er um den dicken Hauskorporal hinauf und karbatschte seinen kirchenfrevelnden Michel, daß die Staubwölkchen herumwirbelten. Der Michel hielt’s aus, stumm wie ein Fisch und ist jetzt (1875) ein bayerischen Bauer groß und stark wie eine Torsäule mit einem Herd von acht dickwangigen Kindern. Der Vater aber geht als Ausnahmer am Stock.
Von Josef Schlicht
Die Hörner der Ochsen mit Knackwürsten behängt
Einen schöneren Bauernsitz muß es nicht gleich gegeben haben, als den Berghof zwischen Münster und Steinach. Er liegt auf einem Vorwaldhügel, der weit ins Straubinger Gäu hinauslacht. Jetzt ist er schon zertrümmert: der Stadel verschwunden, fünf Sölden aus seinem Sturz emporgewuchert, die Erben des Berghofs in ärmlichen Zinsstuben, der letzte Bergbauer vor fünfzehn Jahren als Besenbinder gestorben. Er war der einzige Sohn, an dem Vater und Mutter mit einer wahrhaft kopflosen Affenliebe hingen. Die Mutter ließ ihm ein Kapuzinerkuttlein schneidern, damit, wie ihr ein dummer Aberglaube vorgaukelte, der kleine Berghofprinz nicht sterben durfte; auch hing sie ihm ein Glöckl um den Hals, damit, wenn er ins nahe Holz lief, der Martinerl ja nicht verloren ging. Der Vater sprach den zweischneidigen Wunsch aus: „Wenn unser Martinerl nur amal so groß war, daß er an Vierazwanzga owern (loswerden) kunnt!“ Und siehe, der Martinerl wurde ein Martl und konnte den ersten Zwanziger, zweimal hunderttausend andere und zuletzt den ganzen Berghof „owern“. Der sträflich dumme Vaterwunsch erfüllte sich im einzigen Söhnlein schrecklich. Fuhr er in die Stadt, so sammelten sich alle Saufbrüder um ihn, gaben ihm den Schmeicheltitel „Herr Bergbauer“ und zechten ihm die Taschen halb aus. Heimwärts von den Schrannen führte der Martl gewöhnlich den Witz auf, daß er die Hörner seiner vier Wäldlerochsen mit Knackwürsten behängte. Bei jedem Wirtshaus unterwegs kehrte er ein, gabelte einen Wurstkranz vom Ochsenhorn und hielt alles zechfrei, was nur kommen und trinken und schmausen mochte. Daheim ditschte der ehemalige Martinerl mit ausgestochenen Schlauköpfen: fehlte ihm das Geld, so setzte er einen Bifang, einen Ochsen, eine Kuh, einen ganzen Acker. So ging der schöne, schuldenfreie Berghof Taler um Taler, Stück Vieh um Stück Vieh, Weizenbreite um Weizenbreite zu Trümmern.
Seine zahlreichen Kinder mußten betrübt‘hinaus in die Welt, der Bergbauer selbst mußte zuletzt Besen binden: er trug s‘ ie samstags zur Stadt auf derselben Straße, auf der er mit seinem wurstbehängten Viergespann aus den Schrannen heimgezecht hatte. In seinen allerletzten Tagen buk er sich das schwärzeste Kleienbrot und grub sich die liegengelassenen, halbverfaulten Erdäpfel aus dem Schnee. Und dennoch, als man ihn fragte, wie er es nun mit dem Berghof machen würde, wenn er nochmals anfangen könnte, sagte er: „Grad a so tat i’s wieda macha!“ Aber nachgemacht hat es ihm keiner von den umliegenden Bauern.
Von Josef Schlicht
Wallfahrtskirche in Sossau
Sossau war einst die reiche Hofmark des Klosters Windberg. Dorthin zog es im Sommer auch die Patres, wenn sie einige Zeit Erholung und Muße suchten. Über die Entstehung der Sossauer Kirche gibt es einige Sagen.
Zur Zeit, als die Römer in der Gegend von Straubing lagen, erbauten christliche römische Soldaten an dem Orte, der jetzt Antenring heißt, eine Kirche. Viele Jahrhunderte stand sie, selbst von den Hunnen und Ungarn wurde sie verschont. Von Straubing und überallher wallfahrteten Pilger zu dem Muttergottesbilde der Kirche.
Da kam über jene Gegend mitten im Frieden eine unsichere Zeit. Wallfahrer wurden überfallen und beraubt. Der Muttergottes taten die frommen Pilger leid und sie brachte Hilfe. Englein mußten die Kirche samt dem Bildnis aus dem Orte forttragen. Aber die Kirche war nicht leicht und die Englein mußten dreimal Rast machen. Das erste Mal geschah es in Alburg; der Platz, wo die Engel die Kirche niedersetzten, heißt Liebfrauenfleckl. Sie hoben die Kirche wieder auf und kamen mit ihr bis zu dem Orte, der seither Frauenbrünnel genannt wird. Dort rieselte eine Quelle und die Englein, denen vom Tragen warm geworden war, tranken von dem kühlenden Wasser.
Das dritte Mal rasteten sie in den Fluren von Kagers auf der Schiffsbreiten. Dort warteten sie, bis ein Schiff kam, stellten ihre Last darauf und fuhren über die Donau.
In Sossau ließen sie die Kirche zum letztenmale nieder. Da steht sie noch heute und wird von Wallfahrern aus nah und fern besucht.
Die Karmeliter und Kapuziner von Straubing und der Abt und die Mönche von Windberg wollten später an das Wunder nicht glauben. Sie ließen unter den Mauern nachgraben; da sahen sie selbst, daß die Kirche Unserer Lieben Frau von Sossau keine Grundfeste hat.
Nach Martin Buchner
Das niederbayerische Loretto
Zwei Wegstunden von Bogen steht donauaufwärts am linken Ufer die Wallfahrtskirche Sossau. Früher befand sie sich auf dem rechten Ufer, wurde damals aber oft vom Hochwasser arg bedrängt. Eines Tages war sie wieder in Gefahr, von den Fluten hinweggeschwemmt zu werden. Da kamen des Nachts Engel vom Himmel, trugen die Kirche in ein Schiff, führten sie über den Strom und setzten sie jenseits an einer geschützten Stelle wieder ans Land. Als die Leute morgens erwachten, sahen sie mit Verwunderung die Kirche auf dem linken Ufer. Die Kirche wurde ein vielbesuchter Wallfahrtsort; namentlich pilgern die Frauen gern dorthin.
Nach Emma Böck